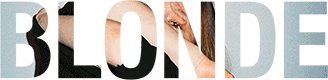Was von der Liebe kaum mehr jemand erwartet, wird bei Freundschaften vorausgesetzt: Lebenslang und bedingungslos sollen sie halten, Seelenverwandtschaft und eine Erweiterung des Ichs sein.
Umso argwöhnischer wird man gemustert, wenn man keine hat. Aber ist ein Leben ohne Langzeitfreunde wirklich so schlimm?
„Wir kennen uns schon seit der Grundschule.“ – „Wenn ich sie ansehe, weiß ich sofort, was sie denkt.“ – „Partner kommen und gehen, aber Freunde bleiben.“ Das klingt ja alles sehr nett. Aber was ist, wenn es einfach nicht stimmt?
Soziologie und Medien sind sich seit Jahren einig in der Behauptung, die Liebe sei die größte Religion unserer Zeit. Der moderne Mensch projiziere in sie all sein Wünsche und Hoffnungen, erwarte von ihr Bestätigung und Halt. Ein großer Trugschluss. Mit der Liebe beschäftigt man sich, man hält sich auf die eine oder andere Weise ein Leben lang mit ihr auf, das stimmt. Aber woran die Menschen wirklich glauben, was sie in ihrer Lebenswirklichkeit unterstützt und ihren Blick auf die Welt stabilisiert, ist die Freundschaft. Je höher die Scheidungszahlen, je instabiler die eigenen Lebenswege, je näher das politische Chaos rückt, desto enger schmiegt man sich an das Konzept Kumpel. Freundschaft ist zur unantastbarsten Institution unserer Zeit geworden. Und ihre Abwesenheit damit zum gesellschaftlichen Todesstoß. Dabei ist sie gar nicht so selten. In England behauptet mittlerweile jeder zehnte Jugendliche von sich, gar keine Freunde zu haben. Aber ist das wirklich ein Grund für Mitleid?
Natürlich ist die Vorstellung schön, eine beste Freundin zu haben, mit der man schon im Sandkasten Burgen für Marienkäfer gebaut hat, die einem im Abi bei den Mathelösungen half, mit der man den ersten Vollrausch und den ersten Liebeskummer durchgestanden hat. Aber vielleicht ist es auch überhaupt kein Verlust, solch eine Verbindung nicht zu haben. Mal ehrlich: Wie wahrscheinlich ist es, sich ein und demselben Menschen ununterbrochen zugehörig zu fühlen? Und ist es wirklich eine so radikal falsche Idee, dass Freundschaften ebenso kurze Halbwertszeiten haben können wie Beziehungen oder Verhältnisse zu Verwandten? Dass sie nicht gelingen oder die Gefühle nicht reichen? Dass man einfach irgendwann das Interesse aneinander verliert? Weil sich einer schneller oder anders weiterentwickelt hat, weil man sich nicht mehr viel und deshalb immer nur das Gleiche zu erzählen hat?
Die Gesellschaft sagt: ja. In keinem anderen Lebensbereich sind Nähe und Abhängigkeit akzeptierter, ja, sogar erzwungener. Was in der Liebe belächelt oder sogar bemängelt wird, gilt in der Freundschaft immer noch als selbstverständlicher Anspruch: Seelenverwandtschaft und eine Verlängerung des eigenen Ichs soll sie sein. Während sich die Formen der Liebe in den vergangenen Jahren zu allen Seiten ausgedehnt haben, es mittlerweile eine Fülle verschiedener Konzepte gibt – monogame, polygame, leidenschaftsarme Beziehungen – ,bleibt das Modell der Freundschaft seltsam starr. Das Ewigkeitsversprechen, das in der Liebe Hysterie auslöst, wird in der Freundschaft nicht hinterfragt. Es gilt als Auszeichnung, immer noch mit den Kameraden aus der Grundschule oder wenigstens dem Studium befreundet zu sein. Auch wenn mittlerweile alle in verschiedenen Städten leben und verschiedene Leben führen – die einen mit Familie und Eigentumswohnung, die anderen im Drittstudium mit WG-Zimmer –, ist man sich angeblich immer noch gleich nah, nichts hat sich verändert. Erstaunlich, dass eine Generation, die die Austauschbarkeit in Beziehungen auf allen anderen Ebenen längst legitimiert hat, Freundschaft für den letzten Heiligen Gral hält.
Ist das nicht verlogen? Menschen, die Beziehungen führen, sind doch die Gleichen, die auch Freundschaften haben. Wieso gehen wir davon aus, dass wir in der einen Hinsicht stabiler empfinden können als in der anderen? Wieso erwarten wir voneinander, dass wir in einem Lebensbereich zur Konstanz fähig sind, während wir doch in allen anderen ununterbrochen daran scheitern? Vielleicht, weil wir meinen, es zu müssen. Weil die Freundschaft unsere letzte Rettung ist. Weil sie das Bild, das wir von uns selbst haben wollen, bestätigt und rechtfertigt. Doch, doch, ich bin liebenswert. Doch, doch, ich kann lieben.
Aber eben auf einem anderen Level. Freundschaften stellen viel niedrigere Anforderungen an uns als alle anderen Beziehungsformen. In der Freundschaft nehmen sich zwei Menschen an, mit Haut und Haar, natürlich. Aber sie müssen sich trotzdem nicht letztgültig miteinander belästigen. Alles das, was wir von Familie und Partnern erwarten, darf die Freundschaft aussparen. Wer pflegt wen im Alter? Wer muss wem in welche Stadt hinterherziehen? Wer stellt seine Karriere für die Familienplanung zurück? Für einen Freund müssen wir nicht einmal gut aussehen. Es gibt in der Freundschaft keinen impliziten Druck. Und genau deshalb gehen wir in ihr gerne über unsere eigentlichen Verantwortlichkeitsgrenzen hinaus. Wir helfen TROTZDEM beim Umzug, wir hören bei Liebeskummer TROTZDEM die ganze Nacht zu, obwohl wir am nächsten Tag arbeiten müssen, wir bringen TROTZDEM Hühnerbrühe ans Krankenbett. Wir mögen uns in dieser Rolle, weil sie uns Freiwilligkeit in der Zuneigung lässt, weil sie sich selbstbestimmter und damit wahrhaftiger anfühlt, als jede Liebesbeziehung es je könnte.
Diese Selbstbestimmung ist schön, aber sie verblendet häufig den Blick auf die anderen Wahrheiten, die es eben auch gibt: Viele Freundschaften sind seit Jahren tot und werden aus Verantwortungsgefühl und Nostalgie trotzdem zwanghaft am Leben gehalten. Künstliche Beatmung durch pflichtschuldige Kinotreffen oder Geburtstagsgeschenke und Urlaubs-SMS. Andere hat man noch nie gefühlt, man mochte die Person, die sich plötzlich zur engen Freundin berufen fühlte, ja, aber man möchte sie bitte nicht ständig sehen. Das zu erklären ist fast unmöglich. Mit Partnern kann man Schluss machen. Aber mit einer Freundin? „Wir können ja Bekannte bleiben.“
Wieso kann man es nicht sagen, wie es ist: Die meisten Freundschaften sind mittlerweile nicht mehr als kurzzeitige Affären. Sie halten für Lebensabschnitte wie Schulzeit, Studium, erster Job oder existieren einzig in bestimmen Lebensbereichen. Einen guten Freund? Habe ich dienstags zwischen 18 und 20 Uhr im Kletterverein.
Und das ist überhaupt nicht schrecklich oder bemitleidenswert, sondern etwas Gutes. Denn manchmal liegt in der vorübergehenden Komplizenschaft eine viel größere Aufrichtigkeit und Nähe. Sogar dann, wenn sie nur im Internet stattfindet. Wenn Menschen, die sich noch nie getroffen und auch keinerlei Ambitionen haben, dies nachzuholen, immer mal wieder Lebensabschnittszeilen schicken, nachts von gescheiterten Lieben oder tagsüber von verrückten Chefs berichten.
Sie werden nie gemeinsam in den Urlaub fahren. Sie werden einander nicht das Taschentuch reichen, wenn mal wieder die Grippe oder der Liebeskummer zugeschlagen hat. Sie bleiben Freundschafts-Affären oder Kumpel-One-Night-Stands. Und in genau dieser Abwesenheit von Zwang liegt oft mehr Verbindlichkeit, als sie viele Uraltfreundschaften vorweisen könnten. Eine Verbindlichkeit nämlich, die aufrichtig ist, weil sie in jedem Moment immer wieder aufs Neue geschlossen wird. Und manchmal eben auch nicht.
FOTO: @mercysus & @vintage fotografiert von JCS