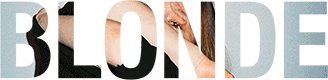Was macht London eigentlich aus, wollten wir von den Bewohnern der Metropole wissen. Das Credo: kulturelle Vielfalt. Der Clash der verschiedenen Einflüsse aus aller Welt, die hier im Melting Pot zusammenfinden. Saris, afrikanische Kostüme, Bindis, Cornrows … Das Angebot ist groß. Doch darf man sich daran nach Lust und Laune bedienen, alles kombinieren und sich aneignen, was eigentlich eines anderen Backgrounds bedarf? Ist es okay, wenn Afrikaner Bindis tragen? Und Kaukasier sich Cornrows machen lassen? Das Thema „Cultural Appropriation“ wird im Netz heiß diskutiert. Blonde-Autorin Katharina Pfannkuch klärt uns auf.
Coldplay, John Galliano, M.I.A., Feierwütige auf dem Fusion-Festival – sie alle standen schon unter Verdacht: Cultural Appropriation sollen sie begangen haben. Cultural was? Deutsche Medien tun sich noch etwas schwer mit diesem Ausdruck und vor allem mit einer griffigen Übersetzung, aber wer in englischsprachigen Magazinen blättert, durch Mode- und Musik-Blogs surft und auf Twitter unterwegs ist, kommt an diesem Schlagwort nicht mehr vorbei: Immer dann, wenn etablierte Künstler traditionelle oder religiöse Symbole weniger privilegierter Kulturen für eigene, kommerzielle Zwecke ausnutzen, ohne sich für deren eigentliche Bedeutung zu interessieren, ist von Cultural Appropriation die Rede.
Und das passiert nicht gerade selten: Im Frühjahr erst schlenderten Coldplay im Video zu „Hymn for the Weekend“ durch die Slums von Mumbai, umringt von dünnen Kindern und eingehüllt in bunte Holi-Farben. Als dann auch noch Beyoncé im Sari und mit Bindi den Refrain sang, war für viele die Grenze zwischen Multikulti-Idylle und Klischeekulisse überschritten. „Wanna depict #India, understand its rich & diverse culture first! Going with ago old stereotypes is not done!”, twitterte eine indische Userin. Ein anderer war einfach traurig: „When your favorite band is problematic as hell for orientalizing and exotifying your culture 😐 Oh, @coldplay“.
Auch John Galliano bekam 2008 Ärger für eine Glitzersandale mit elfenbeinfarbenem Absatz in Form einer afrikanischen Fruchtbarkeitsgöttin. Aus dem, was anderen heilig ist, einen Schuhabsatz zu machen, wirkt nicht gerade respektvoll – in diesem Fall eher rassistisch, fand die Bloggerin Veronica Jamison: „To me the shoes look uncomfortably like European models stepping on the necks of African women.“

Sogar der für alles andere als Profitgier bekannten M.I.A. wurde schon Cultural Appropriation vorgeworfen. Zum Beispiel für ihr Video zu „Bad Girls“, mit dem sie saudi-arabische Frauen unterstützen wollte. Sie benutze verschleierte Araberinnen für eine provokant-exotische Kulisse, so die Kritik. „The video seriously pissed me off. Arab Muslim women aren’t video decor”, hieß es beim Blogger-Kollektiv Patheos.
Und die Besucher des Fusion-Festivals mussten sich erst kürzlich anhören, dass sie als privilegierte Weiße, die mit Dreadlocks und Federschmuck auf Festivals tanzen, nicht weltoffen, sondern ignorant seien. Aus religiösen und historischen Symbolen machen sie nämlich profane Partykostüme, befand zumindest die Bloggerin Hengameh Yaghoobifarah.
Ob auf dem Fusion oder dem Coachella-Festival, früher oder später taucht jemand mit Indianerfederschmuck auf dem Kopf auf. Er ist der Inbegriff der Cultural Appropriation: Laut Tradition darf ihn nur tragen, wer sich für die Gemeinschaft oder im Krieg verdient gemacht hat; aus indianischer Sicht spielt der Federschmuck also in derselben Liga wie die Medal of Honor in den USA oder das Verdienstkreuz in Deutschland. Ein solches Symbol zum It-Piece für Festivals zu machen, ist schon fragwürdig genug.
Spätestens die Geschichte der Vertreibung und Unterdrückung der amerikanischen Ureinwohner durch weiße Siedler erklärt die große Empörung über Karlie Kloss auf dem Victoria’s-Secret-Laufsteg oder Khloé Kardashian auf Instagram mit genau diesem Federschmuck im Haar. Das Symbol einer so unterdrückten Minderheit zum spaßigen Accessoire zu machen, kommt nicht nur geschichtsvergessend, sondern fast schon zynisch rüber.

Aber auch jenseits solcher offensichtlichen Fälle tobt die Debatte darüber, wo die Grenze zwischen Cultural Appropriation und Appreciation verläuft: Teile der schwarzen Community in den USA zetteln einen Shitstorm gegen Kylie Jenner an, weil sie sich Cornrows flicht, Justin Bieber bekommt für seine Dreadlocks Ärger. Der Vorwurf: Tragen Schwarze Cornrows oder Dreads, werden sie diskriminiert, bei Weißen gelten sie dagegen als cool, schimpfen viele User.
Ist das alles berechtigte Kritik oder übertriebene Hysterie? Vor allem ist es ziemlich subjektiv: Was den einen viel bedeutet, finden die anderen einfach hübsch und ausgefallen. Böse Absicht steckt meist nicht dahinter, im Gegenteil. Genau deshalb reagieren die Kritisierten auch so empfindlich auf die Unterstellung, sie würden andere Kulturen leichtfertig ausnutzen.
Interessant wird es, wenn Fantasie und Realität aufeinandertreffen. In kulturellen Schmelztiegeln wie London geschieht genau das ziemlich oft. Die coole Kombi aus Bindi, Bomberjacke und Doc Martens kann indisch-stämmige Personen ziemlich irritieren. Denn für Hindus steht ein Bindi eher für Schakra und Spiritualität als für Boho-Chic. Wer einer marokkanisch-stämmigen Freundin stolz einen Ring mit arabischer Kalligrafie vom Hippiemarkt zeigt, erntet auch nicht unbedingt Begeisterung, wenn sich die so schön geschnörkelte Schrift als Zitat aus dem Koran entpuppt. Für Muslime ist der Koran heilig. Wenn er als Vorlage für ein billiges Ethno-Accessoire herhält, wirkt das eher willkürlich als wertschätzend.
Im angesagten Dashiki-Shirt durch London zu flanieren mag zwar gut für das Mode-Ego sein, das Verständnis westafrikanischer Metropolen-Bewohner könnte sich aber in Grenzen halten: Sie ahnen nämlich, dass die meisten Fashion-Victims keinen blassen Schimmer haben, dass die Idee zum neuen It-Piece aus ihrer Heimat stammt, über die die meisten sowieso nicht wirklich viel wissen, wenn sie denn überhaupt zwischen einzelnen afrikanischen Ländern unterscheiden. Und dann kommt ein westliches Label – in diesem Fall Dimepiece aus den USA – daher und macht aus dem traditionellen Kleidungsstück einen vermeintlich neuen Trend.

Seien wir mal ehrlich: Die meisten von uns erforschen nicht jedes einzelne Ethno-Accessoire auf seine Herkunft und Bedeutung. Pali-Tuch bei Kanye West und Colin Farrell oder Henna-Tattoos bei Madonna und Rihanna wirken erst einmal cool. Die politischen und religiösen Bedeutungen dahinter sind oft Nebensache. Eigentlich komisch: Wenn es um faire Arbeitsbedingungen von Näherinnen in Bangladesch oder nachhaltige Materialien geht, fragen wir doch auch nach. Und die kulturellen Informationen warten ebenfalls nur wenige Klicks entfernt: Wer nur ein bisschen googelt, lernt, dass Cornrows in schwarzen Kulturen auch eine politische Dimension und die verschiedenen Farben westafrikanischer Dashikis ganz spezielle Bedeutungen haben, dass Henna im Islam und auch im Hinduismus zu den Hochzeitsritualen gehört und dass das Palästinensertuch spätestens seit Yassir Arafat auch politische Symbolkraft besitzt.
Der Respekt vor anderen Kulturen, ihren Traditionen und Symbolen ist das eine, ihr wirtschaftliches Ausbeuten das andere. Denn die Gesellschaften, die im besten Fall als Inspirationsquelle und im schlechtesten Fall als Klischeekulisse herhalten müssen, profitieren nicht von dem plötzlichen Boom. Das französische Label Céline verkauft marokkanisch inspirierte Babouche Slipper und wird von Magazinen dafür gefeiert, als gäbe es diesen Schuh in Nordafrika nicht schon seit Jahrhunderten zu einem Bruchteil des Luxusvarianten-Preises. Dennoch verdienen aktuell vor allem Europäer an dem uralten Design aus Marokko.
Das ist das Kernproblem der Cultural Appropriation: Eine privilegierte Elite – Künstler, Designer, bestimmte Gesellschaftsschichten – bedient sich wie aus einem Bauchladen voller bunter Bonbons an anderen Kulturen und verdient an ihnen. Bedenkt man dann noch die europäische Kolonialgeschichte und den US-amerikanischen Umgang mit indianischen, hispanischen und schwarzen Minderheiten, steht der eben noch knallbunte Ethno-Look in ziemlich fahlem Licht da.
Ob, und wenn ja, in welchem Kontext unsere Autorin Cultural Appropriation trotzdem okay und vielleicht sogar kreativ fruchtbar findet, lest ihr in der BLONDE London Issue.
Text: Katharina Pfannkuch
Fotos: Joanna C. Schröder