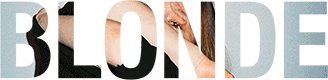An altem festzuhalten hält uns zurück. Hält uns ab vom Glücklichen und Weiterkommen. Wieso verharren wir dann, wenn wir längst zu neue aufbrechen müssten? Ein Plädoyer für Neuanfänge, erzählt in fünf Popsongs.
[separator type=“thin“]
„THIS IS OUR DECISION TO LIVE FAST AND DIE YOUNG. WE’VE GOT THE VISION, NOW LET’S HAVE SOME FUN. YEAH IT’S OVERWHELMING, BUT WHAT ELSE CAN WE DO? GET JOBS IN OFFICES AND WAKE UP FOR THE MORNING COMMUTE?“

Wisst ihr noch, wer ihr sein wolltet in dem Sommer nach dem Abi? Damals, als ihr noch nicht zu Handlangern eines erwachsenen Ichs abgestellt wurdet, um langweiligen Dingen wie dem Geldverdienen eure Zeit zu opfern, weil man auf einmal Miete, Essen, Klamotten bezahlen musste? Damals, als man „live fast, die young“ noch für ein sinnvolles Motto hielt? Als man sich noch nicht nach Ruhe sehnte, nach einem Zuhause? Wer sich solche Fragen stellt, muss sich darauf gefasst machen, dass das Bild von dem jungen, rastlosen Ich nur eine verklärte Momentaufnahme sein könnte. Aber nicht alles, was einem in der Erinnerung schön vorkommt, ist es tatsächlich auch. Ein Idealbild, das nicht mehr zu den realen Lebensverhältnissen passt – von dem mazedonischen Rotwein für 1,29 Euro würde einem heute schließlich nurmehr schlecht. Wer neu anfangen will, muss sich klarmachen, wo er die Machete ansetzt: Wer ist das wahre Ich, das noch unversklavt vom Leben ist? Inwiefern hat es sich weiterentwickelt, wo korrumpieren lassen? Und von was? Klar ist: Wer etwas ändern will, muss zuerst einen Besuch auf dem Seelenschrottplatz unternehmen – und Recycelbares von Plastiktand trennen.
[separator type=“thin“]
„Ich habe geschlafen für so lange Zeit, geborgen in Gewöhnlichkeit.“

Ob es die nobelpreisprämierte Studie der Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky bedurft hätte, um diese Erkenntnis zu formulieren, sei dahingestellt – aber so ist sie immerhin offiziell verbrieft: Der Mensch scheut Verlust. Klar. Ist halt blöd, wenn die einzige Hose, die auf wundersame Weise zu allem passt und jede Gewichtsschwankung mitmacht, irgendwann hinüber ist. Im Laden: „Ah, ja, das Modell haben wir nicht mehr.“ Kurz spielt man mit dem Gedanken, fortan eben einfach keine Hosen mehr zu tragen, weil: Wie es war, wird es eh nie wieder. Wir wollen, was wir kennen. Wir Menschen streben nach Beständigkeit, es beruhigt uns, wenn wir jahrein, jahraus in den gleichen Supermarkt an der Ecke spazieren können; wenn der Kioskverkäufer weiß, welche Zigaretten wir rauchen. Es fühlt sich gut an zu wissen, dass wir sonntags den Kaffee ans Bett gebracht bekommen, weil der Mensch, mit dem wir unser Bett am liebsten teilen, das immer macht. Gewohnheiten, Rituale, geliebte Menschen loszulassen: Das schmerzt. Und so konzentrieren wir uns in Momenten großer Entscheidungen leider eher darauf, was wir zu verlieren haben, statt auf das, was zu gewinnen wäre. Rocko Schamoni schreibt in „Sternstunden der Bedeutungslosigkeit“: „Liebe besteht bei den meisten Menschen nach ein paar Jahren zu 50 Prozent aus Gewohnheit und zu 50 Prozent aus Feigheit.“ Ja, ja, wir wollen das nicht hören, aber er könnte recht haben. Schwerer fällt es, sich einzugestehen, dass das, was er beschreibt, nicht nur für Beziehungen und Lieblingshosen gelten könnte – sondern womöglich auch für den Job, für den man jeden Morgen aufsteht, die Stadt, in der man lebt, das Fach, das man studiert.
[separator type=“thin“]
„Of all the things, I should’ve said, that I never said. All the things we should‘ve done. That we never did. All the things I should‘ve given. But I didn‘t.“
Wir sind viele, viele verpasste Versionen unserer selbst. Mit jedem Weg, den wir einschlagen, bleiben etliche andere ungegangen. Immer mit der Angst im Nacken, das richtige, freie und möglichst wahre Selbst zu verpassen, gehen wir durchs Leben. Mit jeder Entscheidung bereuen wir ein bisschen – ohne zu wissen, ob es uns in anderen Situationen besser ergangen wäre. All die entgangenen Lieben. All die places to see before we die. Die erfüllenderen Jobs. Die beständigeren Jobs. Ein Leben mit Kindern. Ein Leben ohne Kinder. Und das Schlimmste: Es gibt keine perfekte Option. Um die Verpassensängste zu lindern, halten wir viele Türen möglichst lange offen – und drücken uns letztlich davor, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Wir versuchen uns vorerst an kleinen Verbesserungen, optimieren da, wo es leichtfällt. Zweimal die Woche Sport. Gesunde Ernährung. Mehr lesen. Immer noch leichter als eine Kündigung. Das Leben im Mittelmaß ist bequem. Also lieber an der Weggabelung zelten, als sich später eingestehen zu müssen, den falschen Weg genommen zu haben. Und so verharren wir dort, wo wir sind. Nicht zuletzt, weil ein Noch-nicht besser klingt als ein Das-war-nichts. „Und so ist es doch nett, einfach eine Ausrede zu haben, dass man nicht glücklich ist“, heißt es im Film „Lammbock“. Zu merken, dass wir unsere Träume nicht erreichen können, obwohl wir es versucht haben: Das ist die Erkenntnis, der sich niemand freiwillig ausliefern möchte.

[separator type=“thin“]
„It feels like I only go backwards, darling. Every part of me says go ahead. But I got my hopes up again, oh no, not again.“
 In der Popmusik, so Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, habe Authentizität nicht viel zu suchen – im Alltag wiederum scheint sie regelrechtes Diktat (geworden) zu sein. Nicht ohne Folgen. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg schreibt in seinem Buch „Das erschöpfte Selbst“, dass der Zwang, sich selbst zu verwirklichen, Depressionen auslösen könne. Das Phänomen beschreibt er als „la fatigue d’être soi“: die Müdigkeit, man selbst zu sein. Letztlich ist es in der Popmusik wie im Leben dasselbe: Masken bieten Schutz, Ambivalenzen Spielraum. Wir wollen, so weit waren wir schon, uns nicht festlegen. Was wir aber noch viel weniger wollen, ist, uns festlegen zu lassen. Dabei sind wir selbst nicht besser: Auch wir kritisieren verschwendetes Potenzial bei anderen. Wir alle haben Freunde, von denen wir glauben, sie sollten ihr Leben anders leben. Die damalige Punkerin, die heute für eine Unternehmensberatung arbeitet. Der Freund, der mit seiner Frau verheiratet bleibt, obwohl sie ihn langweilt. „Das bist doch nicht du!“, möchte man schreien. Und merkt nicht, dass man den Anspruch – an dem man selbst fast zerbricht – dupliziert. Während wir also in selbstgerechter Scheinheiligkeit unser Umfeld aburteilen, scrollen wir durch die Timelines und gleichen all die stündlich aufploppenden Abschlussarbeiten, Fernreisen und Start-up-Gründungen mit unserem Leben ab. Und denken: Wie langweilig sind wir selbst doch! Eigentlich sollte man ein Café aufmachen. Nur: Wer mit seinen Plänen scheitert, wird gesellschaftlich geächtet. Wie bequem ist es da, das Café doch lieber von jemand anderem in den Ruin wirtschaften zu lassen, sich stattdessen an seinem „But first coffee“-Plakat zu erfreuen, auf Interieur-Blogs zu stöbern und Yogi-Tee zu trinken. Aber: Wer vorwärtskommen will, muss scheitern wollen, schreibt Thomas Bernhard in seiner Erzählung „Ja“: „Indem wir wenigstens den Willen zum Scheitern haben, kommen wir vorwärts und wir müssen in jeder Sache und in allem und jedem immer wieder wenigstens den Willen zum Scheitern haben, wenn wir nicht schon sehr früh zugrundegehen wollen, was tatsächlich nicht die Absicht sein kann, mit welcher wir da sind.“
In der Popmusik, so Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, habe Authentizität nicht viel zu suchen – im Alltag wiederum scheint sie regelrechtes Diktat (geworden) zu sein. Nicht ohne Folgen. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg schreibt in seinem Buch „Das erschöpfte Selbst“, dass der Zwang, sich selbst zu verwirklichen, Depressionen auslösen könne. Das Phänomen beschreibt er als „la fatigue d’être soi“: die Müdigkeit, man selbst zu sein. Letztlich ist es in der Popmusik wie im Leben dasselbe: Masken bieten Schutz, Ambivalenzen Spielraum. Wir wollen, so weit waren wir schon, uns nicht festlegen. Was wir aber noch viel weniger wollen, ist, uns festlegen zu lassen. Dabei sind wir selbst nicht besser: Auch wir kritisieren verschwendetes Potenzial bei anderen. Wir alle haben Freunde, von denen wir glauben, sie sollten ihr Leben anders leben. Die damalige Punkerin, die heute für eine Unternehmensberatung arbeitet. Der Freund, der mit seiner Frau verheiratet bleibt, obwohl sie ihn langweilt. „Das bist doch nicht du!“, möchte man schreien. Und merkt nicht, dass man den Anspruch – an dem man selbst fast zerbricht – dupliziert. Während wir also in selbstgerechter Scheinheiligkeit unser Umfeld aburteilen, scrollen wir durch die Timelines und gleichen all die stündlich aufploppenden Abschlussarbeiten, Fernreisen und Start-up-Gründungen mit unserem Leben ab. Und denken: Wie langweilig sind wir selbst doch! Eigentlich sollte man ein Café aufmachen. Nur: Wer mit seinen Plänen scheitert, wird gesellschaftlich geächtet. Wie bequem ist es da, das Café doch lieber von jemand anderem in den Ruin wirtschaften zu lassen, sich stattdessen an seinem „But first coffee“-Plakat zu erfreuen, auf Interieur-Blogs zu stöbern und Yogi-Tee zu trinken. Aber: Wer vorwärtskommen will, muss scheitern wollen, schreibt Thomas Bernhard in seiner Erzählung „Ja“: „Indem wir wenigstens den Willen zum Scheitern haben, kommen wir vorwärts und wir müssen in jeder Sache und in allem und jedem immer wieder wenigstens den Willen zum Scheitern haben, wenn wir nicht schon sehr früh zugrundegehen wollen, was tatsächlich nicht die Absicht sein kann, mit welcher wir da sind.“
[separator type=“thin“]
„Got kicked in the head, so I started a fight, cause I knew I was right. But I learned I was wrong, I remember a slaughter, I remember I fought. For the money I brought, I got blistered and burned and lost what I earned. But I live and I learn, yes I live and I learn.”
Es gibt kein Richtig, kein Falsch, nur Steckenbleiben. Wir dürfen an der Weggabelung zelten. Wir dürfen für Frauenrechte kämpfen und beim Autofahren misogynen Rap hören. Wir können in der einen Woche betrunken Autospiegel abtreten und in der Woche drauf das Juraexamen schreiben. Es gibt Konflikte, die kann man nicht vermeiden – und das darf so sein. Wir dürfen widersprüchlich sein, wir dürfen unzusammenhängend sein. Wir sind ja keine Bachelorarbeit. Neu anzufangen heißt, die Erkenntnis zu riskieren, dass alles, was man zuvor für richtig gehalten hat, nicht, nicht mehr oder nur teilweise haltbar ist – nicht zwangsläufig falsch, aber nicht mehr zwingend aktuell. Und manchmal heißt Neuanfangen auch, sich dazu zu zwingen, die Schönheit einer blanken Leinwand zu erkennen. Tabula rosa.
Text: Katharina Heckendorf // Fotos: Marlen Stahlhuth