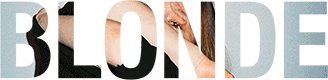Wissen um Verlust und Vergänglichkeit ist zur größten Stärke unserer Autorin geworden. Sie ist Kind der 80er-Jahre, sie ist Kind der Deutschen Demokratischen Republik. Dies ist die Geschichte ihrer Kindheit in der DDR.
Ich bin behütet aufgewachsen, draußen vor den Toren Berlins, in Sicherheit und mit viel Liebe in einem Mehrgenerationenhaus. Unten wohnten meine Großeltern mit meiner Tante, in der Mitte meine Eltern, unterm Dach wir Kinder. Eine eigene Wohnung bekamen meine Eltern nicht, denn Platz gab es im Haus genug und Wohnraum war Mangelware. Meine Eltern waren beide berufstätig, wie auch meine Tante und Großeltern.
Kindheit in der DDR: Von Eislaufen und Schlüsselkindern
Von Montag bis Samstag ging ich in die Schule. Zuerst waren wir in einer kleinen Grundschule untergebracht. Eine leicht marode, aber hübsche Gründerzeitvilla. Ab der zweiten Klasse zogen wir um in den Neubau. Groß und modern war hier alles. Wir hatten eine eigene Turnhalle und einen Pausenhof mit Wasserzugang, leider war Baden streng verboten. Im Winter kamen wir übers Eis gelaufen, es war kürzer – und lustiger. Erwischt werden durfte man dennoch nicht, denn die zu erwartenden Disziplinarmaßnahmen waren ein zu vermeidendes Übel. Das waren dann so Sachen wie Aufsätze über gutes Verhalten schreiben oder sich beim Fahnenappell vor der Schule entschuldigen. Wer braucht schon so was? Stolz waren wir auf unsere neue Schule, war es doch nicht selbstverständlich, dass alle Kinder gleichermaßen ein solches Privileg genießen konnten. So hatten wir es gelernt. Wir waren zwölf Kinder in der Klasse. Alle kamen wir zu Fuß, mit dem Rad oder der Straßenbahn. Allein, klar. Einige waren Schlüsselkinder, die trugen ihre Schlüssel an einem Lederbändchen um den Hals, weil sie vor ihren werktätigen Eltern nach Hause kamen, andere gingen in den Hort.

Foto: Esther Seibt/Christian Lue via Unsplash
Ich stromerte die meiste Zeit mit meinen Freunden draußen rum. Im Wald, am See, in der Eisdiele, was auch immer uns einfiel. Wir fühlten uns sicher und unsere kleine Welt war voller Erlebnisse. Unsere Schokomilch kam aus dreieckigen Pappkartons, die wie kleine Pyramiden aussahen, Bonbons und Brause waren beliebte Tauschmittel und manchmal fuhren wir zum Alexanderplatz auf Entdeckungsreise. Herrlich. Die Freundschaften waren eng und unsere Abenteuer schienen keine Grenzen zu kennen. Und doch, natürlich, war sie da: die Grenze. Sie war da, wenn ich zweimal die Woche am Endbahnhof Friedrichstraße ausstieg, um zum Ballett zu gehen. Oben patrouillierende Grenzer mit ihrer Uniform in gewichtigem Schritt, im Anschlag das mächtige Gewehr. Unten der „Tränenpalast“, in dem täglich Abschied genommen wurde von jenen, von denen man getrennt wurde durch eine Grenze, die mitten durch ein Volk verlief. Sie war da, wenn manche Kinder nach Besuchen der West-Verwandtschaft eine echte Barbie von Mattel mitgebracht bekamen, während ich mit einer fragwürdigen Sandy spielte. Und die Grenze war auch da, wenn wir in den Sommerferien an die Ostsee fuhren. Wenn mein Vater uns erzählte, dass hinter dem Horizont Dänemark sei und dass man dort nicht einfach hinkönne.
Unsere Schokomilch kam aus dreieckigen Pappkartons, die wie kleine Pyramiden aussahen, Bonbons und Brause waren beliebte Tauschmittel und manchmal fuhren wir zum Alexanderplatz auf Entdeckungsreise. Die Freundschaften waren eng und unsere Abenteuer schienen keine Grenzen zu kennen.
Es gab Kinder, deren Eltern lebten in vorauseilendem Gehorsam und waren „aufrechter“ als die Fahnenstange vorm Schulgebäude. Es gab die Revoluzzer und die Idealisten und dann noch jene, die einfach gar nichts waren. Sie hatten eine Arbeit, besorgten sich und ihren Nachbarn Ketchup, wenn es mal welchen in der Kaufhalle gab, waren mal mehr und mal weniger zufrieden. Ein fast ganz normales Volk, eine fast ganz normale Kindheit mit dem einen Unterschied, dass wir in einem Modellprojekt aufwuchsen. Und das nannte sich Sozialismus. Je weiter die 80er-Jahre voranschritten, desto schärfer wurde der Ton. Das Thema um die Lage zwischen Ost und West wurde häufiger diskutiert, während der Staat zusehends mauerte. In der Schule wurde intensiv besprochen, was geschehen war im Zweiten Weltkrieg und dass es doch eine bessere und sozialere Lösung für die Menschen im Miteinander hatte geben müssen. Darin waren sich alle einig. Zugleich wurde verschönt, was nicht zu verschönen war, und auch unter uns Kindern kam vermehrt Unruhe und gegenseitige Ablehnung auf – sind Kinder doch gerne unverblümt im Ausdruck. So auch wir. Wir wurden häufiger von Lehrern befragt, was wir im Fernsehen sahen, wo wir im Urlaub waren, was gegessen wurde. Nicht von allen, nicht dauerhaft. Und doch. Bei manchen Eltern wurde vermutet, dass sie Stasi-Spitzel waren. Es gab Geschichten, wie dem einen oder anderen Benachteiligungen widerfuhren, da er kritische Äußerungen von sich gegeben hatte. Die Stimmung kippte merklich und aus Kontrolle schien Wahn zu werden.
Und plötzlich fiel sie, die Mauer
Hoffnung kam auf, denn so hatte es mit der kleinen DDR nicht weitergehen können. Wenn ich den Menschen ihre Freiheit nehme, nehme ich ihnen auf Dauer die Luft zum Atmen. Viele hatten Träume und Wünsche an die neu gewonnenen Möglichkeiten. Dennoch, auch die Freiheit hat ihren Preis. Meiner war sehr hoch. Am Tag nach der Grenzöffnung war die Klasse bis auf drei Kinder leer. Unsere Lehrer waren zum Großteil verschwunden. Nach wenigen Wochen verloren meine Eltern wie auch die meisten ihrer Freunde die Arbeit, dann ihre Häuser und Wohnungen gefolgt von akademischen Errungenschaften, Pensionsansprüchen, Rücklagen bis hin zu ihrer individuell gelebten Vergangenheit. Denn wer in der DDR gelebt hatte, musste gelitten oder aber gekatzbuckelt haben, jede andere Geschichte konnte nur erfunden sein. Dass auch sie einfach Kinder und Jugendliche gewesen waren mit alledem, was dazugehört, hatte keine Gültigkeit mehr.

Ich war gerade aus dem Gröbsten raus, verstand zu wenig und fühlte zu viel. Von eben auf jetzt hatte ich alles, was mir Stabilität gab, verloren. Familien brachen auseinander. Freunde waren von einem Tag auf den anderen weggezogen. Lehrer, wenn es welche gab, wussten nicht, was sie unterrichten durften. Das Geld reichte nicht. Meine Großeltern erkrankten schwer und wurden von meiner Mutter gepflegt. Einem nach dem anderen hielt sie die Hand auf dem Sterbebett und ich hielt die ihre. Missgunst und Neid griffen um sich, geliebte Menschen nahmen sich das Leben, Freunde verloren sich in Drogen. Immerfort ging es bergab. Von null auf 100 oder von 100 auf null.
Ich wurde immer wieder gefragt, ob Ost- oder Westberlin, um dann das abschätzige Kräuseln der Lippen ertragen zu müssen: „Du wirkst gar nicht wie eine Ossi, versuchst wohl, das zu verheimlichen.“
In dem Jahr, in dem ich das Abitur machte, bestritt ich drei Jobs. Für Kinos und Cafés war keine Zeit. Ich wusste mehr über Behandlungsmethoden von Krankheiten als über meine wenigen Freunde. Ich wurde immer wieder gefragt, ob Ost- oder Westberlin, um dann das abschätzige Kräuseln der Lippen ertragen zu müssen: „Du wirkst gar nicht wie eine Ossi, versuchst wohl, das zu verheimlichen.“ Nichts hatte Bestand, nichts war selbstverständlich, außer dass alles, was kam, auch wieder gehen musste. Vergänglichkeit und Verlust waren die Essenz meines Seins geworden. Lange wusste ich nicht, woher ich die Leichtigkeit nehmen sollte, meine Jugend zu genießen in einer Welt, in der es plötzlich nur noch Gewinner, Reiche und Schöne gab – nur ich gehörte irgendwie nicht dazu.

Und doch, nach Jahren des Eskapismus und der Verlustängste, wo ich sie nicht vermutet hatte, da war sie und verschaffte sich Gehör: meine Freiheit. Ich begann mit Yoga, Meditation und den verschiedensten Therapien. Ich probierte mich aus und suchte endlich nach Lösungen. Ich lernte Dankbarkeit für alles Erlebte, hatte es mir doch mehr Erfahrung geschenkt als den meisten Menschen in meinem Alter. Ich lernte endlich, zu kanalisieren und dieses gelebte Wissen für mich zu verwenden, im Job wie privat.
Die Wunde der Vergangenheit als Stärke der Zukunft
Mein Wissen um die Dinge macht mich stolz, auch weil es gelebtes Wissen ist. Es lässt mich entspannter neuen Aufgaben begegnen und gibt mir das Gefühl, egal was kommt, ich werde es meistern, auch wenn ich anfänglich keine Ahnung habe wie. Ich habe verstanden, dass meine größte Stärke in meiner tiefsten Wunde liegt und dass Vergänglichkeit dem ewigen Kreislauf von Kommen und Gehen Wertigkeit verleiht. Vertrauen, Geduld, Hingabe – die Lehrstücke des Verlusts. Das, was war, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Danke, mein kleines Land, dass es dich gab, und danke, dass es heute anders ist! Signing off to be young again.
Text: Esther Seibt