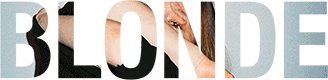Zeig mir deine Wohnung und ich sag dir, wer du bist. Wir stellen euch Modemenschen, Freunde und Wegbegleiter mitsamt ihrer vier Wände vor. Design oder Selfmade? Verspielt oder clean? Souterrain oder Dachterrasse? Wir schauen uns um und nehmen euch mit: BLONDE zu Besuch bei … Suvi Häring.
Ihr kleines Reich liegt im Berliner Stadtteil Neukölln im vierten Stock eines sorgsam renovierten Altbaus mit offener Wohnküche. Der unverbaute französische Balkon zum Hinterhof gewährt einen großzügigen Blick in hundert Jahre alte Kastanienwipfel, die zu dieser Jahreszeit in voller Blüte stehen. Wer in Finnland aufgewachsen ist, war stets umgeben von zahllosen Inseln, kristallklaren Seen, unberührten Wäldern und schneeweißen Landschaften. So ist auch Grafikdesignerin und Art-Direktorin Suvi Häring die Nähe zur Natur noch immer ein Grundbedürfnis. Selbst in Berlin – einer Stadt, die sie vor allem für ihre geistige und emotionale Freiheit schätzt, fernab von dem Drang, alles und jeden in kategorisierenden Schubladen verstauen zu wollen. Schubladen, in die sie ihr ganzes Leben schon nicht so recht zu passen schien und heute nicht mehr passen möchte.
Vielmehr ist die hübsche Blondine aus dem rauen Norden eine wahre Schatzsammlerin: Alles in ihrer liebevoll eingerichteten Studiowohnung birgt eine ganz persönliche Erinnerung in sich und hat damit nicht nur einen festen Platz in ihrem Herzen, sondern auch auf einem ihrer vielen kleinen Schreine gefunden. Im Alltag schaut sie aber lieber nach vorne als zurück. Immer mit der Intention einer großen Querdenkerin, nicht nur Teil der Zukunft zu sein, sondern diese auch maßgeblich mitzubestimmen. Vielleicht prangt an ihrer Küchenwand auch deswegen ein Auszug aus der unendlichen Zahlenfolge der Fibonacci-Zahlen, die sie gerade auswendig zu lernen versucht – natürlich nur so weit, wie sie kommt.
Du kommst eigentlich aus Finnland, woher genau?
Aus Savonlinna inmitten von Saimaa, dem Land der tausend Seen. Wohin man auch blickt: Wasser und Wald. Ich bin ein absolutes Forest Girl und könnte problemlos einen Monat im Wald überleben, wenn ich denn müsste. [lacht]
Nach deinem Abitur hat es dich trotzdem ganz schnell nach Deutschland verschlagen. Warum?
Ich musste unbedingt raus, um etwas von der Welt zu sehen. Es gibt so viele Vorurteile gegenüber den Deutschen, ich wollte mich selbst davon überzeugen, was stimmt und was nicht. Also machte ich mich spontan auf und landete erst einmal mehr zufällig in Fürth bei Nürnberg.
Vom Niemandsland in Finnland ins Niemandsland in Bayern?
Sozusagen! [lacht] Aber das war für mich schon aufregend genug, immerhin konnte ich kein Wort Deutsch und hatte noch nie zuvor eine U-Bahn benutzt. Ich wusste nicht einmal, dass man einen Knopf drücken muss, wenn man aussteigen will. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich in dieser neuen „Großstadtwildnis“ zurechtgefunden habe. Witzigerweise waren es aber genau diese Schwierigkeiten, die mir gezeigt haben, dass ich auch ein City Girl bin. Und mittlerweile weiß ich: Ich brauche beides gleichermaßen, Stadt und Natur.
Du hast dann schließlich in Nürnberg studiert, in Helsinki und New York gelebt und gearbeitet. Heute sitzen wir hier in Berlin. Was unterscheidet Berlin von den anderen Städten?
In New York hat man jederzeit die Wahl: Doc Martens oder High Heels? Es gibt so viele Möglichkeiten, dass einem nie langweilig wird. Das ist etwas, wovor ich große Angst habe: Langeweile! Auf der anderen Seite ist in New York alles schon so festgefahren. Das hat mich gestört. Als ich dann nach Berlin kam, habe ich nur gedacht: „Das ist sogar noch besser!“ In Berlin sind die Menschen entspannter und weniger bedeutungsschwer.
Wie bist du dazu gekommen, Grafikdesign zu studieren?
Ich wusste immer, dass ich einen künstlerischen Beruf ausüben möchte. Ich habe trotz Bemühungen einfach nie in eine andere Schublade gepasst. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich eine Handvoll Zeichnungen im Gepäck, mit denen ich mich an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg vorgestellt habe. Eher um einen Rat zu erbeten als alles andere. Sie legten mir sofort nahe, mich zu bewerben. Da alles sehr schnell gehen musste, hatte ich nur drei Tage Zeit. Ein Freund gab mir zum Üben und als Inspiration einen Pferdeschädel, den ich heute noch habe. Am Ende bestand mein Portfolio tatsächlich fast nur aus Studien zu diesem Schädel. Und auf einmal war ich drin. Das erste Semester hatte ich aber erst einmal keine Ahnung, was Grafikdesign war. [lacht]
In New York hast du für keinen Geringeren als Designlegende James Victor gearbeitet. Wie war das so?
Den ersten Satz, den ich von ihm zu hören bekam, als ich mich vorstellte, werde ich nie vergessen: „Designers are assholes.“ Er benutzte für all seine Arbeiten, egal welchen Zwecks, lediglich eine Schriftart. Ich hingegen war damals total vernarrt in Typografien und gleichermaßen fasziniert und schockiert von seiner beinahe ignoranten Herangehensweise. Von da an konzentrierte ich mich mehr auf die Bedeutung einer Arbeit als nur auf die reine Ästhetik. Plötzlich war es nicht mehr das Perfekte, sondern das Unvollkommene, das mich interessierte. Ganz im Sinne des polnischen Designers Henryk Tomaszewski, der mal gesagt hat: „Beauty, ugly, I don’t know the difference.“
Ist das auch deine Definition von „gutem Design“?
Ich entscheide mich bei meinen Arbeiten oft bewusst gegen das Perfekte, um Inhalte und Nahbarkeit zu schaffen. Ästhetik basiert ja auch auf Balance – darauf, etwas loszulassen und gleichermaßen doch kontrollieren zu können. Es geht immer um den Kontrast zwischen dem Unvollkommenen und dem Vollkommenen, zwischen Logik und Unlogik. Wenn das gewährleistet ist, ist es in meinen Augen gut!
Spiegelt sich das auch in deinen eigenen vier Wänden wider?
Absolut. In meinen Arbeiten kreiere ich sehr klare, minimalistische Welten, während ich hier versuche, einen Gegenpol zu schaffen und nicht alles bis ins kleinste Detail durchzudesignen. Ich bevorzuge deshalb lieber DIY-Möbel, auch weil ich oft eine sehr genaue Vorstellung davon habe, wie etwas auszusehen hat, und es dann am Ende einfach selber mache.
Was bedeutet zu Hause für dich?
Auch hier wieder: Inhalte. Alles, was sich in dieser Wohnung befindet, hat eine Geschichte. Es geht mir nicht zwangsläufig um die dekorative Seite von Objekten oder darum, wie schön etwas ist – Schönheit ist ja eh etwas sehr Oberflächliches –, sondern eher um die persönliche Beziehung, die ich zu den Dingen hege, und erst im zweiten Schritt um das ästhetische Moment. Ich möchte vielmehr ein „environment of meaning“ kreieren, um mir nicht nur einen Rückzugsort, sondern auch eine inspirierende Kreativstätte zu schaffen.
Sprich alles in deiner Wohnung ist ein Sammelsurium aus Dingen, die dir etwas bedeuten?
Ja und nein, zumindest nicht willkürlich. Denn eigentlich folgt alles in meinem Leben – wahrscheinlich berufsbedingt – einem Plan und einer Struktur. Vielleicht eine, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, aber sie ist da. Ich bin jedoch überzeugt, dass man Chaos auch mal zulassen muss. Solange das ein System hat, ist das kein Problem. [lacht] Wenn hier zum Beispiel ein Berg Klamotten herumliegt, finde ich trotzdem immer mit dem ersten Handgriff, was ich suche.
War die Wohnung Liebe auf den ersten Blick?
Auf jeden Fall! Als ich die großen Fenster und dann noch das riesige Bad gesehen habe, war die Entscheidung klar. Ich habe sofort gewusst, wo der Tisch stehen wird. Alles andere habe ich dann nach und nach drumherum gebaut. Als Erstes kam eine Matratze, danach ein Stuhl und so weiter. Es fasziniert mich, wie uns unser Umfeld beeinflussen kann – unsere Gefühle und geistige Verfassung. Mir jedenfalls ist der Schnitt einer Wohnung extrem wichtig.
Was genau macht persönliche Ästhetik deiner Meinung nach aus? Ist das etwas, das man lernen kann, oder ist Geschmack eine Folge unserer Herkunft und Sozialisation?
Ich sehe da auf jeden Fall einen Zusammenhang, ja. Alles, was wir in unserer Kindheit erleben, prägt uns! Erinnerungen und Gefühle aus dieser Zeit werden uns ein Leben lang begleiten. Daraus ergibt sich dann natürlich ein ganz persönliches Empfinden in Bezug darauf, was man als perfekt empfindet. Und es geht ja darum, sich zu Hause zu fühlen. Ich zum Beispiel fühle mich zu Hause, wenn ich koche, weil ich als kleines Mädchen viel Zeit mit meiner Mama in der Küche verbracht habe – das beruhigt mich.
Du hast einen sehr kreativen und gleichermaßen geistig vereinnahmenden Alltag. Wohin gehst du in Berlin, wenn dir das alles zu viel wird und du mal ausspannen musst?
Joggen, am liebsten am Kanalufer. Das reinigt mein System, macht meinen Kopf frei. Wenn ich mal richtig rausmuss, bin ich ein Freund von Spontan-Trips. Letztes Jahr habe ich beispielsweise noch beim Frühstück einen Flug nach Lissabon gebucht. Am Abend stand ich dann dort und bin einen Monat geblieben. Ich kann ja von überall in der Welt arbeiten. Alles, was ich brauche, ist eine funktionierende Skype-Verbindung. Das ist meine Vorstellung von einem zeitgenössischen Arbeitsalltag.
Freiheit spielt also eine große Rolle?
Ja, zumindest die Illusion von Freiheit, eine wirkliche Freiheit ist das ja auch nicht. Die Illusion ist aber schon genug, um mich ruhig zu stellen. Schwierig wird es, wenn ich mich eingeschlossen fühle, dann kann ich nicht kreativ sein. Deswegen funktioniert ein Alltag mit zu vielen Regeln und Einschränkungen für mich nicht. Ich glaube, dass auch nur ein spannendes Leben spannende Ideen und Projekte hervorbringen kann.!
In Anlehnung an die Idee des „letzten Abendmahls“: Wenn du noch eine Sache konsumieren, sehen oder erleben dürftest, was wäre das?
Der Wald! Wir haben jeden Tag so viel in unseren Köpfen, dass ich es bevorzugen würde, mich als letzte Maßnahme von allen diesen Gedanken zu lösen. Egal wohin wir in unserem Alltag schauen, überall sind wir umgeben von Nachrichten oder Menschen, die etwas von uns wollen. Die Natur hingegen ist unkontrollierbar und stellt keine Forderungen an uns. Ich würde mich wahrscheinlich in einen See stellen oder auf eine große Wiese legen. Irgendwohin, wo ich für mich selbst absolut präsent sein könnte.
FOTOS: Paul Aidan Perry