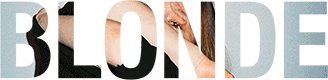Boris Halva hat ein Buch über Männer geschrieben. Und über die Konsequenzen, einer zu sein. In einer exklusiven Leseprobe lest hier ihr von falschen Mannsbildern und kontroverser Werbung – und davon, warum darin nicht das wahre Problem liegt.
Männergeschichten seien selten Heldenstorys, in denen es um Macht und Maseratis gehe, sagt Autor Boris Halva. Es seien vielmehr Geschichten vom Scheitern und Schönreden, von Ohnmacht und Orientierungslosigkeit. Boris Halva ist wütend, wenn er sich mit den Geschichten beschäftigt, die oft von und über Männer erzählt werden. Es sind Gedanken, die in unserer (pseudo-) liberalen Blase gerade überall kursieren und die trotzdem noch zu wenig das System infrage stellen. Halvas Buch „Mannsbilder” fordert deshalb gerade im euch hier präsentierten Auszug: Mehr Aktion als Reaktion.
Der Autor will die Männer aber – natürlich – nicht alle über einen Kamm scheren. Manche Männer, so Halva, hätten einfach nur schlechten Stil, geschmacklosen Humor, und so weiter. Und er will jenen, die sich mittlerweile vielleicht zu „netten, mittelalten, weißen Männern“ entwickelt haben könnten, auch gar nicht zu viel Raum geben. Das Männerbild beeinflussten sie ohnehin schon zu Genüge.

Leseprobe: „Mannsbilder” von Boris Halva – Kapitel „Der empörte Mann – von schiefen Bildern und unglücklicher Werbung”
„Mit dem Bild vom Mann zu spielen ist eine heikle Angelegenheit. Denn wenn es darum geht, mit ihren unschönen Seiten konfrontiert zu werden, da verstehen die Herren offensichtlich weder Spaß noch Ironie.
Als der Rasierbedarf-Hersteller Gillette im Frühjahr 2019 in einem Werbespot tatsächlich mal das Beste im Mann präsentierte, das doch bis dahin immer ein Rätsel geblieben war – wo ist dieses Beste und kann man das wirklich rasieren? –, war die Zielgruppe überhaupt nicht amused. Irgendwie war es vielen, die sich den Clip angesehen hatten, gelungen zu übersehen, dass Gillette da auch selbstironisch mit eben jenem Bild des Mannes spielte, das die Firma selbst über Jahrzehnte in ihrer Werbung gefeiert hatte: dem Superkinn-Sixpack-Mann, der den Schaum in seinem Gesicht so lässig und entschlossen mit dem Nassrasierer teilt, wie er auf seinem Jetski über die Wogen des Lebens fliegt. Tschüss, alter Macho, stand da zwischen den Zeilen, es war nett mit dir, aber nach #MeToo und dem ganzen Mist, der an der toxischen Männlichkeit hängt, wollen wir jetzt mal die inneren, aufrechten Werte feiern.
»Stahlhart angebiedert« schrieb Daniel Dillmann in der Frankfurter Rundschau in seinem Kommentar zum Spot.
Und genau das ist der Punkt: Wenn Mann dem Spot etwas vorwerfen konnte, dann doch vor allem, dass er einfach ein bisschen zu gewollt war, ein bisschen zu sehr betonte: »Seht her, wir haben erkannt, was bisher falsch gelaufen ist! Eigentlich sind wir doch alle gute Jungs und bitte, bitte: Habt uns lieb!« Darum ging es. Und was macht die Netzgemeinde? Wittert mal wieder erhobene Zeigefinger, Anklage, Kollektivhaftung! »Wir sind keine Arschgrapscher und Weggucker, die immer nur am Grill stehen«, wurde da von empörten Männern getwittert und gepostet. »Wir sind nicht alle schlecht! Und überhaupt: Wie kommt eine Firma dazu, sich anzumaßen, Männer so pauschal schlechtzumachen?« Die Empörung gipfelte dann in Fotos von zerbrochenen Einwegrasierern und Aufrufen zum Boykott dieser Klingen, die so gar nichts bringen – außer einem schlechten Leumund.
Gillette bemühte sich redlich, das Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Aber so, wie ein Witz nicht mehr zu retten ist, wenn einem am Anfang schon ein Teil der Pointe rausrutscht, so konnte die Presseabteilung des Unternehmens der international grassierenden Hysterie nichts mehr entgegenhalten.
Als Procter & Gamble Anfang Mai 2019 etwas schlechtere Quartalszahlen als üblich präsentierte, mutmaßten einige, das sei die Folge der verunglückten Gillette-Kampagne.
Wenn schon ein im Kern gut gemeinter Spot solche negativen Folgen haben konnte, durften wir gespannt sein, in welchem Umfang sich die Muttertagswerbung des Lebensmittelmarktes Edeka auf die Quartalszahlen auswirken würden. Da war ja was los! Von wegen, Männer könnten keinen Mixer bedienen oder Haare kämmen! Männer machen zwar nicht alles perfekt, aber so grobschlächtig und ungeschickt wie in diesem von der Hamburger Agentur Jung von Matt erdachten Werbefilm sei ja nun wirklich kein Mann mehr – heutzutage jedenfalls nicht! Also endeten die Netzkommentare zum Werbeclip überwiegend mit Ausrufen wie: Männerfeindlich! Peinlich! Ekelhaft! Ein sehr verärgerter Mann startete sogar eine Petition gegen den Spot, der sich eine Woche später bereits 703 (!) Unterzeichner angeschlossen hatten. Und Unterzeichnerinnen. Denn in diesem eindeutig geschmacklosen Fall von Männerbashing stand auch so manche Dame dem starken, guten und mitunter auch schönen Geschlecht entschieden zur Seite. Dass Edeka knapp drei Wochen später einen Vatertagsspot hinterherschob, der Papa als subversiven Kumpanen der Kinder feierte, weil er, hihi, zum von Ma- ma gedünsteten Gemüse Ketchup rumreichte, wurde mitunter wohlwollend, aber von den meisten dann doch mit einem eher müden Lächeln quittiert.
Es gab aber auch Männer, die erstaunt angesehen wurden, weil sie sich über den Muttertagsspot überhaupt nicht aufregten: »Wie? Das lässt dich kalt?« – »Ja, das lässt mich kalt. Weil es zu plump ist, um sich aufzuregen.«
Zweifelsohne dürfen wir die Macht der Bilder, die von der Werbung entworfen werden, nicht unterschätzen. Das Bild, das dort von Männern und Frauen gezeichnet wird, macht natürlich etwas mit uns. Und es prägt auf diese Weise auch das Bild bestimmter Menschen und wie wir sie sehen. Und prägt also auch, wie wir die Welt und wie die anderen die Welt sehen, in der wir uns bewegen. Wer von uns kennt nicht wenigstens ein halbes Dutzend Werbeslogans aus der Kindheit, ganz gleich, ob wir in den Sechzigern, Achtzigern oder um die Jahrtausendwende aufgewachsen sind? Aber genauso gilt auch: Wer seine Stärken kennt und seine Schwächen nicht ignoriert, lässt sich doch von einem Defilee abgeschmackter Klischees nicht aus der Ruhe bringen.
Wie leicht das Spiel mit Ironie in die Hose gehen kann, das haben nicht nur Gillette und Edeka vorgeführt. Auch die Betreiber eines feministischen Veganercafés in Australien, in dem Männer 18 Prozent mehr für Speisen und Getränke zahlen mussten, haben nur wenige Monate nach dem ersten Hype den letzten Sojacappuccino boniert und danach die Ladentür verrammelt. Die Idee der Männersteuer – den Betreibern zufolge ein satirischer Verweis darauf, dass Männer immer noch in vielen Berufen mehr verdienen als Frauen und von daher auch für ihren Kaffee etwas mehr bezahlen könnten – fanden die Kunden nicht so lustig.
Aber sobald auf strukturelle Ungleichheiten hingewiesen wird – und sei es mit einem Augenzwinkern –, kommen immer welche um die Ecke, die Männerhass wittern und sofort »Diskriminierung« twittern. Und wenige Sekunden später lesen Tausende flüchtig drüber und schieben ihren Quark hinterher. Und dann ergießt sich eine Lawine unflätigen Blödsinns über die vermeintlichen Männermobber. Was beweist: Manche Diskussionen sind zu komplex, um die Menschen damit im Alltag zu konfrontieren. Andererseits ist diese Konfrontation wichtig, um überhaupt ein Bewusstsein für bestehende Probleme zu schaffen. Denn die gibt es zuhauf. So hat auch das Thema Frauenparkplätze in den vergangenen Jahren verlässlich für Schlagzeilen gesorgt. Grundsätzlich kann man sagen: Natürlich wird ein Mann ungleich behandelt, wenn für Frauen extra Parkplätze ausgewiesen werden. Diese Ungleichheit wird aber qua Gesetz legitimiert, weil es sachliche Gründe für diese Ungleichbehandlung gibt. Etwa das Sicherheitsbedürfnis von Frauen, die viel häufiger Opfer von Überfällen und Vergewaltigung werden. Der Einwand eines Klägers, Frauenparkplätze diskriminierten Männer, ist daher vor Gericht schon häufiger ins Leere gelaufen. Im Frühjahr erst versuchte im bayerischen Eichstätt ein Mann, gegen Frauenparkplätze zu klagen, die seiner Ansicht nach seine allgemeine Handlungsfreiheit einschränkten. Er bemühte zu diesem Zwecke ein, wie er wohl meinte, ziemlich ausgefuchstes Argument: Das Schild vermittle doch den Eindruck weiblicher Schwäche – sei damit also diskriminierend. Die Chancen dieser Vorlage wurden bereits vorab als äußerst schwach eingeschätzt, auch weil das Argument des Klägers so offensichtlich polemisch war.
Aber abgesehen von den absurden Wortklaubereien rund ums Thema Frauenparkplätze (auf die wahlweise mit pinkfarbenen Schildern hingewiesen wird oder die mancherorts sogar mit Pink auf den Asphalt gemalt werden, aber das ist noch mal eine andere Geschichte): Der Gillette-Spot und das Männersteuer-Café sind Beispiele dafür, dass Aktionen ebenso wie Argumente noch so hintergründig und gut durchdacht sein können – wenn zu viele Kurzdenker darauf aufmerksam werden und über ihre Verteiler einen Shitstorm lostreten, dann bleibt für die Initiatoren nur Hoffen und Beten.
Doch der Mann wird in seiner Selbstwahrnehmung nicht nur in der Werbung angegangen. Es werden auch einige zweifelhafte Hashtags durchs Netz gejagt. #menaretrash zum Beispiel hat, gelinde gesagt, für so manche Diskussion gesorgt. »Männer sind Müll«, das schrieben junge Südafrikanerinnen, nachdem mehrere Mädchen und Frauen vergewaltigt und getötet worden waren. Es ging darum, die Welt darauf aufmerksam zu machen, dass es Männer gibt, in deren Augen das Leben einer Frau nichts zählt. Das Hashtag #menaretrash kehrt diese Haltung radikal um, Hass und Verachtung werden gegen die Männer gerichtet. Ein drastischer Schritt, ein Akt der Verzweiflung, nachvollziehbar nur im Kontext der Morde in Afrika.
Aber #menaretrash blieb nicht dort, wo es aufkam. Auch hierzulande wurden Männer zu Müll gemacht, eine Bloggerin nannte das Hashtag »das derzeit einzig sinnvolle«. Das mag vielleicht nur eine Provokation gewesen sein, aber eben auch eine von der plumpen Sorte, so wie die Muttertagswerbung. So mancher fragte dann auch zu Recht: Wenn Männer Müll sind, warum trefft ihr euch denn dann noch mit ihnen? Doch so beunruhigend es sein mag, dass solche Slogans um die Welt gehen – dem so schnell und mitunter leichtfertig geschürten Hass stellen sich vielerorts immer auch gemäßigte Stimmen entgegen. So schrieb eine Frau: »Männer sind kein Müll, denn Menschen sind generell kein Müll!« Das ist so banal und zugleich so zutiefst wahr, das kann hier jetzt erst mal so stehen bleiben.
Damit aber jenseits von Empörung und ironischen Brechungen wirklich ein neues Männerbild entstehen kann, müssen nicht nur die Damen und Herren in PR-Abteilungen und Werbeagenturen ihre Kampagnen hinterfragen. Alle Frauen und Männer müssen sich die Fragen stellen: Wie soll er sein, der neue Mann? Und was müssen wir tun, um ihm den Weg zu bereiten? Wo ist unser Engagement, unsere Toleranz, unser Wohlwollen gefragt?
Der Philosoph Leander Scholz, der in seinem Essay »Zusammen leben« herausarbeitet, warum die Fürsorge, wie sie in Familien gelebt wird, als tragende Säule der Gesellschaft zu wenig Beachtung findet, sagt an einer Stelle mit Blick auf das Leben als Paar und Eltern: »Damit ein neues Männerbild entstehen kann, das den Anforderungen eines gleichberechtigten Lebens entspricht, müssen auch Frauen ihren Blick auf die Männer und ihre Erwartungen an sie überprüfen.« Und da geht es nicht nur um die Fragen »Was stört mich, und wie hätte ich es gern?«, sondern auch darum zu ergründen, worin diese nervigen Eigenschaften des anderen wurzeln – und wo meine Erwartungen eigentlich herkommen? Und warum lasse ich mich von dieser Empörung da draußen so schnell mitreißen?
Diese Fragen müssen sich sowohl Männer als auch Frauen stellen. Denn nicht nur Männer stecken in Rollen fest – und das nicht immer zu ihrem Besten, wie Jagoda Marinić in ihrem Buch »Sheroes« gleichsam verständnisvoll und auffordernd anmerkt. Auch Frauen hocken mitunter in ihrem angerosteten Rollenkäfig und sind so damit beschäftigt, das Beste daraus zu machen, dass ihnen nicht auffällt, dass die Tür nicht abgeschlossen ist.
Und ob es nun um vermeintlich überholte Klischees in Werbespots oder wirklich drastische Themen wie #MeToo oder alltäglichen Rassismus geht – es reicht nicht zu sagen: »So sind wir nicht!« Es geht darum, es zu zeigen. Denn: Empörung kann mehr, Empörung muss mehr wollen, als nur den Boykott von Firmen zu fordern, die sich offenbar für dieses Frühjahr vorgenommen hatten, das ökonomisch riskante Geschäftsfeld »Earned Media« mal intensiver zu bespielen, um herauszufinden, inwieweit es sich auszahlt, Aufmerksamkeit für die Marke über Empörung zu generieren.
Ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt: Wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, worum es wirklich geht. Wenn wir uns über jeden vermeintlich männerdiskriminierenden Clip empören, der hochgeladen wird, wächst die Gefahr, dass wir irgendwann nicht mehr erkennen können, was denn das wirklich Skandalöse an der Sache ist, über die wir uns gerade aufregen. Oder dass wir immer nach etwas suchen, worüber wir uns aufregen können, denn: Wer permanent etwas kritisiert, ist wichtig. Oder glaubt zumindest, es zu sein. Stichwort Empörungsdividende. Also: Nicht aufregen, aufrichten! Und klarmachen: Ich bin kein Klickaffe. Ich bin weder Claqueur noch Verstärker.
Wir müssen uns Pausen gönnen, um innezuhalten und nachzudenken. Und dann erkennen wir, dass ein großer Teil dieser Bilder, über die wir uns aufregen, nicht bloß der Fantasie auf Krawall gebürsteter Werber entspringt, sondern der Realität. Mag sein, dass diese Bilder nicht den modernen Mann widerspiegeln, aber es gab diese Typen.
Es ist einiges falsch gelaufen, das lässt sich nicht leugnen. Und es läuft noch immer einiges falsch, das lässt sich nicht wegklicken.
Darüber sollten wir reden. Nicht darüber, warum der nächste James Bond keine Frau sein darf. Und auch nicht über Werbespots!”