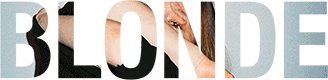Aids ist besonders häufig in Osteuropa ein Tabuthema. Wie lebt es sich mit einer Krankheit, über die man nicht sprechen darf?
Bunte Kondome auf Gemüse, große Plakate, Kinowerbung, Beratungsstellen und Aufklärung sind für uns eine Selbstverständlichkeit, doch in vielen osteuropäischen Ländern sind sie das nicht. Verdrecktes Drogenbesteck, Sex ohne Gummi und die Angst vor Diskriminierung sind Gründe dafür, warum die Dunkelziffer der HIV-Positiven besonders in Ländern wie Russland, der Ukraine oder auch Rumänien neue Dimensionen annimmt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt, dass zu wenig Aufklärung und eine geringe medizinische Versorgung die Ansteckungsgefahr weiter steigen lassen. Und die Zahlen beweisen: Die Infektionsrate in Osteuropa und Zentralasien hat sich zwischen 2010 und 2016 um 60 Prozent erhöht, gerade mal 28 Prozent aller Infizierten werden überhaupt behandelt. Doch die dortigen, oft stark traditionalistischen Gesellschaften schweigen über Auswirkungen und Folgen. Kriminalisieren statt Informieren lautet die Devise. Infizierte werden nicht nur von Mitmenschen, sondern auch von Behörden, Lehrern, Arbeitgebern oder sogar der eigenen Familie schikaniert und verurteilt. Heutzutage sind AIDS und das Sterben daran vermeidbar, wenn es mehr öffentliche Test- und Präventionsangebote geben würde. Während weltweit die Zahlen der Neuinfektionen zurückgehen, hat sich der Anstieg in Osteuropa über die Jahre drastisch erhöht. Das hat nicht nur bildungstechnische Gründe, sondern zum Teil auch politische oder religiöse. Hilfsorganisationen unterliegen staatlichen Restriktionen und veraltete konservative Meinungen sorgen für ein feindliches Klima. Drei junge Menschen sprechen über ihr Leben zwischen Krankheit und Tabuisierung.
[infobox maintitle=“Jekaterina, 29, Moskau“ subtitle=““ bg=“red“ color=“white“ opacity=“off“ space=“30″ link=“no link“]
„Ich war Teenager, als ich erfuhr, dass ich HIV-positiv bin. Ich hatte damals einen ‚Bad Boy’ als Freund und meine konservative Mutter war nicht nur gegen diese Beziehung, sondern strikt gegen Sex vor der Ehe. Aus jugendlicher Rebellion haben wir es dann erst recht getan – ohne Gummi oder vorher darüber nachzudenken. Weil alles so schnell ging, hatte ich Angst, schwanger zu sein, und fuhr zu einem Arzt. Dieser testete mich auch auf HIV. Ich wunderte mich warum, aber machte mir mehr Sorgen um eine Schwangerschaft. Das Testergebnis hat mein ganzes Leben in einer Sekunde umgedreht. In meinem Kopf rasten die Gedanken: Was bedeutet das? Wer kann mir helfen? Wem soll ich es sagen?
Manchmal frage ich mich, was aus meinem damaligen Freund geworden ist, ob er noch lebt und ob ich ihm vielleicht hätte helfen müssen.
Ich dachte, dass ich höchstens noch ein paar Jahre lebe, und flüchtete aus der Praxis. In meiner Schule sprachen die Lehrer nicht mit uns über Sex, geschweige denn über Verhütung oder AIDS. Ich wusste nichts darüber. Täglich fühlte es sich an, als wartete ich auf meinen Tod. Von meinem Freund hatte ich mich direkt nach dem Testergebnis getrennt, ohne ein Wort darüber zu verlieren, weil ich Angst hatte, dass er es allen erzählen würde und niemand mehr etwas mit mir zu tun haben wollte. Meiner besten Freundin beichtete ich schließlich, dass ich HIV-positiv bin. Sie ging mit mir in eine Klinik. Die Ärzte verweigerten aber die Behandlung, da sie keine Medikamente vorrätig hatten. Ich fühlte mich unglaublich entmutigt. Irgendwann fasste ich neuen Mut, recherchierte im Internet und fand eine NGO, die eine Anlaufstelle in Moskau hatte. Dort bekam ich nach einigen Monaten endlich die Hilfe, die ich brauchte, medikamentös und vor allem psychisch, und brachte so auch endlich den Mut auf, es meiner Mutter zu sagen. Natürlich war sie geschockt, ich weiß noch bis heute, wie sie mich erschrocken angesehen hat. Aber entgegen meinen Erwartungen kümmerte sie sich um eine Behandlung meiner Krankheit, sodass ich heute noch hier sitze. Manchmal frage ich mich, was aus meinem damaligen Freund geworden ist, ob er noch lebt und ob ich ihm vielleicht hätte helfen müssen, so wie meine Mutter und Freundin mir geholfen haben.“
[infobox maintitle=“Artem, 24, Charkow “ subtitle=““ bg=“gray“ color=“white“ opacity=“off“ space=“30″ link=“no link“]
„Religion spielt in meiner Familie eine große Rolle. Wir beten vor jeder Mahlzeit und meine Eltern haben mir immer wieder Geschichten über Sünden und deren Bestrafung erzählt. Dazu gehörte auch Homosexualität. Ich hatte schon in der Pubertät gemerkt, dass ich Jungs attraktiver finde, aber es immer verdrängt. So wie es sich gehörte. Schließlich zog ich zum Studieren vom Land in die Stadt und lernte einen Typ kennen, der offen schwul war. Ich verliebte mich und wir wurden heimlich ein Paar. Bis dahin hatte ich beim Sex mit Frauen immer verhütet, doch bei meinem ersten Mal mit einem Mann sah ich keinen Sinn in einem Kondom.
Als mein Arzt mir das Ergebnis des HIV-Tests mitteilte, mitteilte, hatte ich das Gefühl, er wollte so weit es geht von mir wegrutschen.
Ein Jahr später stand die Beziehung vor dem Aus und es begann die schlimmste Zeit meines Lebens. Alles kam raus. Mein Cousin outete mich vor meiner ganzen Familie als schwul. Weil ich mehrmals eine Mandelentzündung hatte, testete mich mein Arzt auch auf HIV. Ergebnis: positiv. Als er mir das mitteilte, hatte ich das Gefühl, er wollte so weit es geht von mir wegrutschen. Meine Familie schämte sich für meine Homosexualität und bezeichnete sie als Krankheit, deshalb traute ich mich nicht, ihnen auch von meiner echten Krankheit zu erzählen. Ich fühlte mich wie ein Aussätziger und dachte, ich wurde für meine Sexualität bestraft. Als die ersten körperlichen Beschwerden auftraten, kam auch meine Depression. Ich glaubte, dass mir eh niemand helfen würde, und schämte mich für mein Unwissen über Aids, bis ich an der Universität eine Selbsthilfegruppe für psychische Probleme fand. Dort lernte ich Jacob kennen, ebenfalls HIV-positiv und depressiv. Uns war klar: Wir mussten uns gegenseitig helfen. Er gab mir den Mut, mich medizinisch behandeln zu lassen, und hielt meine Hand, als ich das erste Mal in einer Klinik war. Ohne ihn wäre es vermutlich zu spät für mich gewesen. Aber das bleibt unser Geheimnis. Für meine Familie bin ich immer noch der Kranke, für den sie beten.“
[infobox maintitle=“Marina, 21, Bukarest“ subtitle=““ bg=“red“ color=“white“ opacity=“off“ space=“30″ link=“no link“]
„Meine Mutter war früher drogenabhängig. Sie lebte in krasser Armut und infizierte sich durch eine geteilte Nadel mit HIV. Ich habe diesen Virus von ihr geerbt. Ich bekam früh Medikamente und hatte kaum Beschwerden. Viel schlimmer war, wie andere Menschen auf mich reagiert haben. Meine Mutter versuchte immer, mich zu schützen. Mein Schulleiter aber hielt sich nicht an seine Geheimhaltungspflicht und von da an war ich überall die Kranke, die Eklige, das Kind einer verseuchten Frau.
Mir fiel es schwer, Leuten zu vertrauen, und ich hatte keine richtigen Freunde.
Die anderen Kinder sagten Sachen wie: ‚Fass sie nicht an, sonst bekommst du es auch!’ In der Pause wurde ich oft verhauen, die Lehrer standen da und taten nichts. Ich erzählte zu Hause davon und wir gingen zur Polizei; doch sie sagten nur, ich solle einfach zu Hause bleiben, da ich krank sei, dann würde mir auch nichts passieren. Letztlich wurde uns nahegelegt, mich auf eine Sonderschule zu schicken. Meine Mutter zog mit mir um in der Hoffnung, dass sich mein Leben verbessern würde, wenn ich noch einmal von vorne anfangen konnte. In der neuen Schule hielt ich meine Krankheit geheim. Mir fiel es schwer, Leuten zu vertrauen, und ich hatte keine richtigen Freunde. Als ich dann meinen Abschluss machte, wollte ich eine Ausbildung anfangen. Der erste Arbeitgeber verlangte ein ärztliches Attest von mir und lehnte mich direkt ab. Genau so war es bei drei weiteren Bewerbungen. Ich lebte so lange zu Hause bei meiner Mutter, bis sie starb. In der Zeitung las ich dann von einem Anstieg an jungen Erwachsenen in Rumänien, die sich mit HIV infizieren, auf der Straße leben und ohne ärztliche Versorgung auskommen müssen. Ich bewarb mich bei einer Hilfsorganisation, die mit einer mobilen Ambulanz versucht, die Krankheit einzudämmen. Sie nahmen mich an – und ich hatte das erste Mal das Gefühl, meine Krankheit steht mir nicht im Weg. Im Gegenteil. Ich arbeite immer noch bei der Organisation und bin froh, wenigstens für andere Infizierte etwas tun zu können.“
Foto: Joana C. Schröder