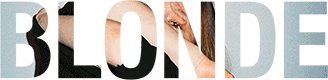Das Video eines Uni-Projekts machte die Studentin Maggie Rogers über Nacht zum viralen Star und Liebling der Musikwelt. Auf ihrem zweiten Album „Surrender” löst sie sich von Fragen, die ihr Debüt geprägt haben – und macht die Platte zum Teil ihrer Masterarbeit.
Das letzte Mal sah ich Maggie Rogers, als sie im März 2019 auf der Bühne des Hamburger Mojo Clubs stand. Tief in den Katakomben der unterirdischen Konzerthalle performte sie die Songs ihres Debütalbums „Heard It In a Past Life”. Es war das Werk, das aus ihrem ersten Erfolg eine Karriere mit großem Plattenvertrag gemacht hatte und Maggie auf internationale Bühnen brachte. Und dennoch: In gewisser Form stand auf dieser Bühne noch die Frau, die als Studentin den Grundstein für ihre Karriere gelegt und durch ein Uni-Projekt zu Bekanntheit gekommen war. Im weiten T-Shirt und verwaschener Jeans sang Rogers ihre Songs, bis sie sich unterbrach und einem filmenden Fan in der ersten Reihen das Handy aus der Hand nahm. Es sei okay, zu filmen, sagte sie damals, wenn aber der Fan nicht Teil der Show sei und ihr das Handy ins Gesicht halte, wäre sie damit nicht einverstanden. „Ich habe vergessen, dass ich sowas damals gemacht habe!“, lacht Maggie Rogers heute. Sie trägt ein Ringelshirt, die Haare jetzt kurz geschnitten, und sitzt mir gegenüber, na ja, zumindest auf dem Screen, zugeschaltet aus einem Berliner Hotelzimmer. Es regnet vor ihrem Fenster, aber schon der Kaffee am Morgen habe ihr Freude bereitet, erzählt die 28-Jährige. In Berlin hat Rogers viele Freund*innen aus ihrer Studienzeit in New York, das Wochenende hat sie mit einigen von ihnen spontan auf Mallorca verbracht. „Übers Wochenende nach Mallorca zu fliegen, das scheint mir recht deutsch”, überlegt Maggie. Wenn sie nur wüsste.
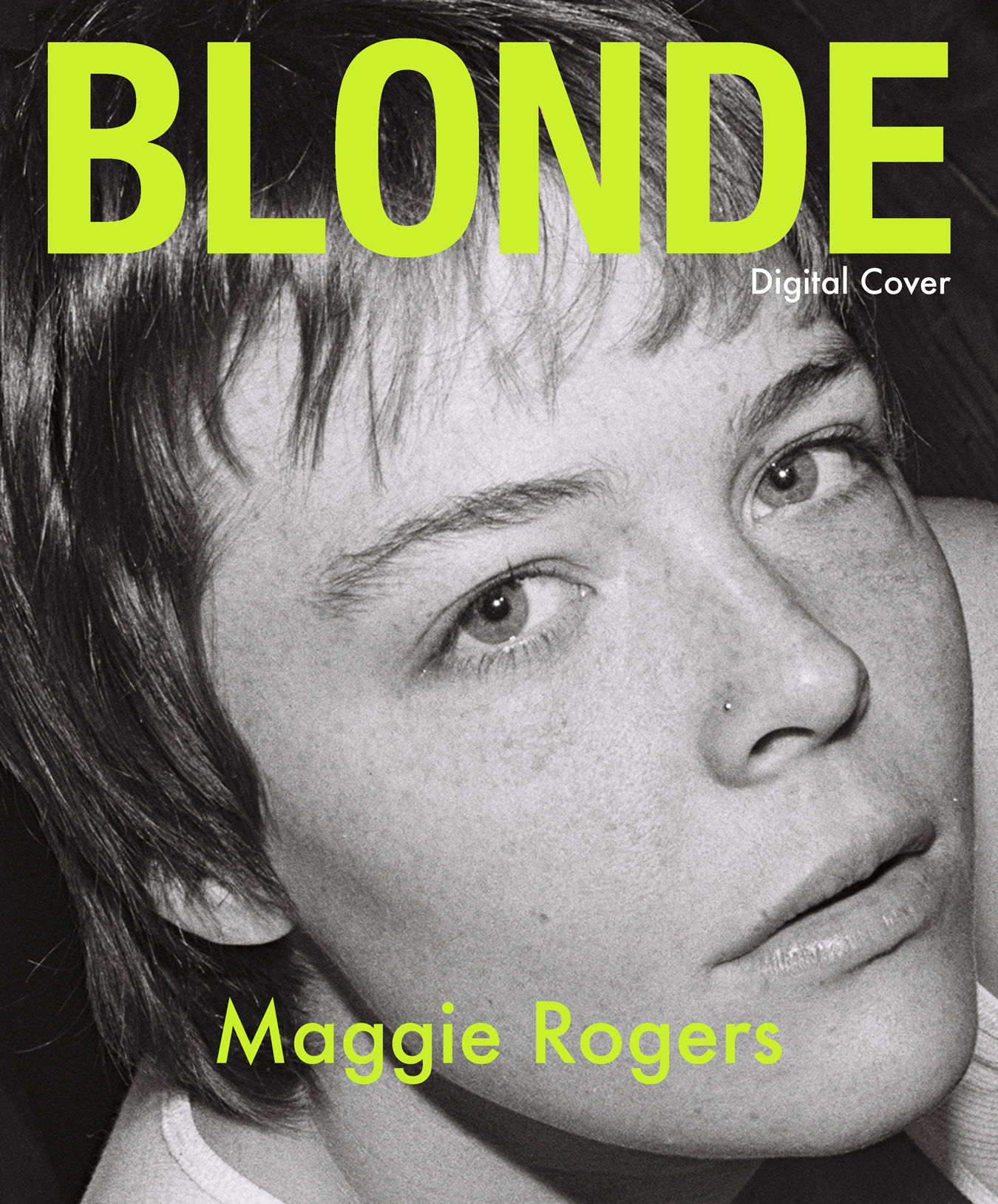
Foto: S. Holden Jaffe (Del Water Gap)
Über Fan-Religion und öffentliches Leben
Bevor wir aber in den Austausch über kartoffeldeutsche Tourist*innen-Ziele verfallen, sprechen wir lieber darüber, wie Rogers heute über das Fan-Dasein und Live-Shows denkt. Die Erkenntnisse dafür hat die Musikerin innerhalb der letzten Jahre gewonnen: Maggie Rogers wurde bekannt durch ein virales Video, in dem sie als Studentin an einer Masterclass des ikonischen Sängers und Producers Pharrell teilnahm. Nachdem er zum ersten Mal Maggies Song „Alaska” hörte, verblieb der Musiker begeistert und ohne jegliche Kritik. Rogers würde schlicht und einfach ihr eigenes Ding durchziehen, lautete Pharrells Fazit. „Alaska” war Teil ihrer EP „Now That The Light Is Fading“, die Rogers im Rahmen ihrer ersten Abschlussprüfungen in Musik und Englisch konzipierte. Es folgte: Das Debütalbum, die Welttournee, ein Status auf der Schwelle zwischen Pop- und Rockstar, aber auf jeden Fall als Lieblings von Musikfans. Ihre Verbindung zum eigenen Fan-Dasein hat Rogers nie verloren. Vielleicht bewog genau diese Verbindung sie sogar dazu, das Ganze noch einmal akademisch zu analysieren: Inmitten der Pandemie kehrte Maggie zurück an die Uni – an die Graduiertenschule Divinity der Universität Harvard, um genau zu sein. Vor Kurzem machte sie hier ihren Master-Abschluss in „Religion and Public Life”. Der neue Studiengang, zu dessen ersten 11 Absolvent*innen Rogers gehört, richtet sich laut Harvard Divinity an Berufserfahrene, die im Bezug auf ihre Karriere „tiefgründiges Wissen erlangen wollen, wie Religion auf komplexen Wegen das öffentliche Leben beeinflusst.” Rogers untersuchte in ihrer Arbeit kulturelles Bewusstsein, die Spiritualität öffentlicher Versammlungen und die Ethik von Macht in der Popkultur. Ihre Masterstudien haben aber zum Teil noch etwas anderes zuvor gebracht: Maggie Rogers zweites Album, „Surrender”.
„[Beim Coachella] ging ich auf die Bühne, nachdem ich einfach drei Jahre lang keine Live-Musik gemacht hatte – und ich hatte so viel Spaß. Es gab keinen Raum für Gedanken, ich hatte einfach nur Riesenspaß.”
Coachella, das Kolloqium
Künstler*innen und Musiker*innen, die wieder zurück an die Uni gehen – das ist nicht unbedingt eine Seltenheit. Die wenigsten aber werden Arbeit und Bildung so verknüpfen wie Maggie Rogers. Zu den Anforderungen ihres Master-Studiengangs gehörte eine öffentliche Präsentation. Für Maggie war das ihre Performance beim diesjährigen Coachella-Festival. „Da dachte ich, ich würde auf die Bühne gehen und all diese Theorien im Kopf haben und alles klar vor mir sehen“, erzählt die Musikerin von ihrem Auftritt. „Und dann ging ich auf die Bühne, nachdem ich einfach drei Jahre lang keine Live-Musik gemacht hatte – und ich hatte so viel Spaß. Es gab keinen Raum für Gedanken, ich hatte einfach nur Riesenspaß.” So weit hätte es nicht kommen müssen: Eigentlich, so erzählt Rogers, habe sie Album und Abschlussarbeit voneinander trennen und die Platte noch fertigstellen wollen, bevor sie ihre Studien begann. Nun weiß sie, dass es genau die Verbindung beider Teile brauchte. Und dennoch behandelt Maggie Rogers ihren Abschluss in unserem Gespräch zögerlich. Ich möchte mehr darüber wissen, wie das ist, ein Musik-Album mit der Masterarbeit zu verbinden. Als ich aber merke, dass unser Gespräch an eine Studienberatung zu grenzen beginnt, verweist auch Rogers höflich auf ihre Grenzen. Viele wollten gerade gerne über ihren Abschluss sprechen, sie aber natürlich lieber über das neue Album. „Meine Arbeit in der Grad School ist…also, ich habe den Abschluss erst vor zwei Wochen gemacht. Es ist noch sehr frisch. Und ich fühle mich nicht super wohl, das fühlt sich sehr privat an.”
„Konzerte gehörten schon immer zu den spirituellsten Erfahrungen, die ich je hatte. Von allen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, kommt das der Religion am nächsten.”
Woran glaube ich?
Dass Maggie Rogers gut Limits setzen kann, bleibt erkennbar von ihrer Handy-Fan-Interaktion beim Konzert, über die sie nun lacht, bis in unser Gespräch. Sie hält die Konversation mit aufrichtiger Freundlichkeit, bleibt aber klar, wenn etwas nicht passt. „Ich denke nicht, dass ich schon bereit bin, öffentlich darüber zu sprechen, aber ich schätze diese Frage”, antwortet Rogers auf jene, ob sie nach all den Studien zu Religionen auch eine eigene Form der Spiritualität gefunden habe. So viel aber erzählt sie: „Konzerte gehörten schon immer zu den spirituellsten Erfahrungen, die ich je hatte. Von allen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, kommt das der Religion am nächsten.” Und: „Während der Pandemie habe ich mich oft gefragt: Woran glaube ich? Ich denke, dass das mit einem immensen sozialen Wandel einhergeht, der in den USA stattfindet. Es hat damit zu tun, dass man sich wirklich Gedanken über die Welt machen muss, an der man teilhaben und die man gestalten möchte.”
Diese Fragen verbinden Rogers vermutlich mit vielen 28-Jährigen an der Schwelle zwischen Weltgeschehen, Berufsleben, Studium, der nächsten Sinnkrise oder doch dem Start in gefestigte Lebenskapitel. Für Maggie, die – wie sie Musikjournalistin Eve Barlow mal verriet – „sehr langsam” aufgewachsen ist, hat der erste Erfolg Fragen um den Raum zwischen ihrem privaten und öffentlichen Ich aufgeworfen, die sie auch auf ihrem ersten Album verarbeitet.
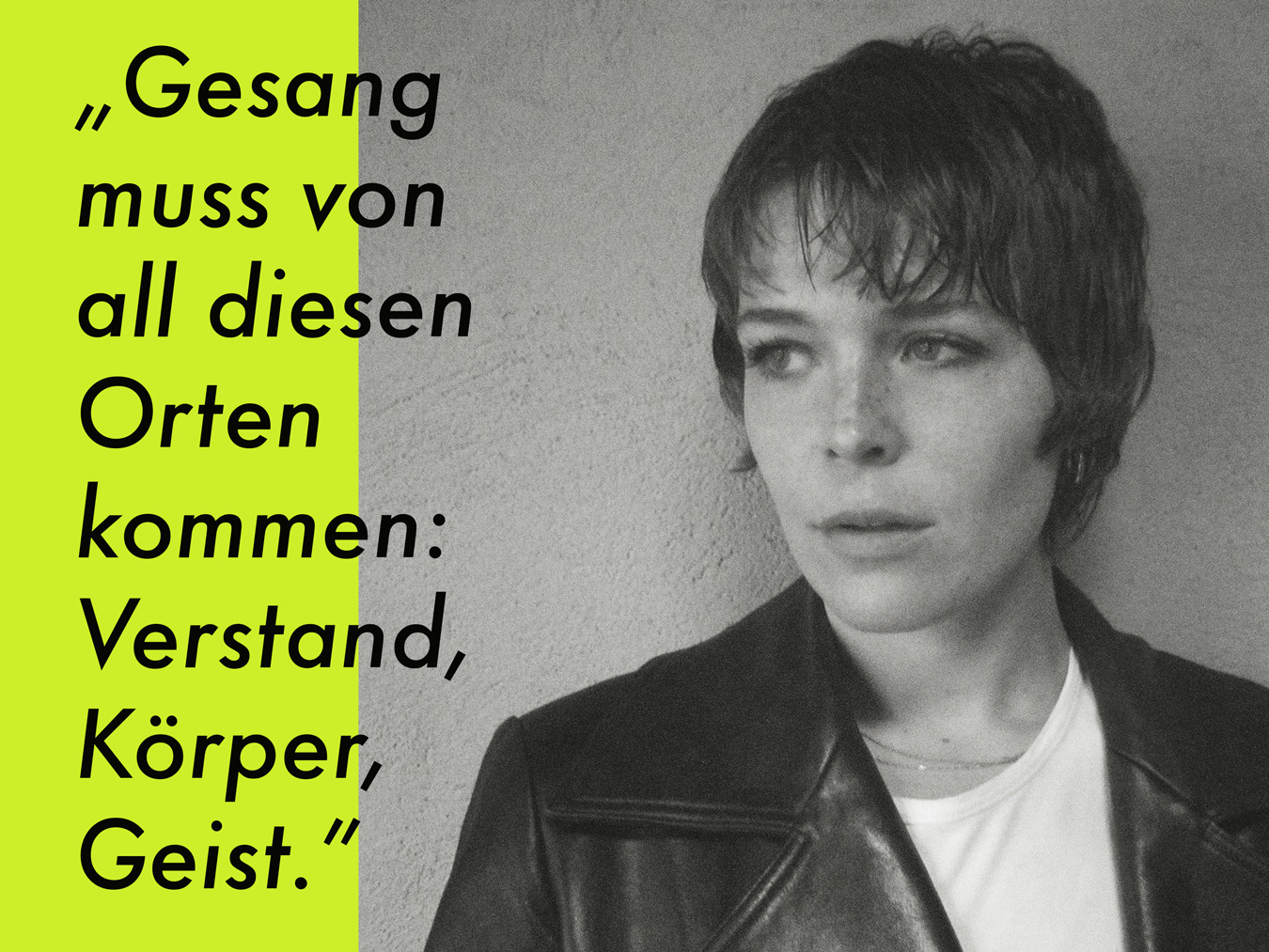 Foto: Olivia Bee
Foto: Olivia Bee
Von Zähnen und ungezähmter Freude
Bei der Vorbereitung stoße ich auf ein weiteres Thema: die Metapher der Körperlichkeit. Zwischen ihrem Debütalbum und „Surrender” erschien Rogers Album „Notes From The Archive: Recordings 2011–2016”, eine Sammlung alter Songs, die sie unabhängig als Studentin veröffentlicht hatte. Auf diesem Album findet sich der Song „Resonant Body”. Zum Klang eines gezupften Banjos singt Maggie hier über ihre Rippen als Schlagzeug, Akkorde auf ihrer Zunge und über die dissonanten Töne ihres Körpers, was in Realität viel weniger gruselig oder kitschig klingt, als es sich hier lesen mag. Die Körperlichkeit zieht sich weiter bis in Rogers beste Songs. So gibt es auf ihrem Debütalbum den eindrucksvollen Schlusstrack „Back in My Body“, in dem sie von ihren Panikattacken während der ersten Tour erzählt. Als sie wiederum den Sound des neuen Albums beschreibt, verwendet Maggie beinahe zufällig dieselbe Metapher: Sie definiert die neuen großen Drums, die verzerrten Gitarren auf „Surrender” als „Chaos, das [sie] kontrollieren kann” – und als etwas, das sie „zurück in [ihren] Körper” schickt – back into her body, eben. Auf diesem Album könnten außerdem Zähne eine wichtige Metapher für Emotionen sein. Sie kommen in gleich zwei Songs vor, in „Shatter” und „Want Want”, der zweiten Single und einem der besten Songs der neuen Platte. „But I didn’t want to admit/ That when we’re cheek to cheek/ I feel it in my teeth/ And it’s too good to resist“, singt Maggie über röhrende Gitarren, gelayerte Chöre ihrer eigenen Stimme und die großen Drums. Es geht um Sex, um ungebändigte Emotionen und Vergnügen. Nach „feral joy”, der animalisch ungezähmten Freude, hat Maggie Rogers auch ihre kommende Tour zum Album benannt.
„Bei „Surrender” ging es für mich darum, so viel zu fühlen, wie du nur kannst, als Ausdruck dessen, dass du am Leben bist. Ich bin eine Sängerin, also ist mein Körper mein Instrument.”
„Bei „Surrender” ging es für mich darum, so viel zu fühlen, wie du nur kannst”, erklärt sie, „als Ausdruck dessen, dass du am Leben bist. Ich bin eine Sängerin, also ist mein Körper mein Instrument. Er ist der zentrale Ort, von dem ich Klang und Gesang erschaffe. Gesang muss von all diesen Orten kommen: Verstand, Körper, Geist, vor allem aber kommt er eben aus dem Körper. Und du spürst diese Resonanzfrequenzen ja auch im ganzen Körper. Wenn du aber emotional nicht im Einklang mit dem bist, was du singst, wird dein Resonanzpotential nicht so hoch sein, wie es könnte.“ Maggie Rogers fühlt Inspiration als Kribbeln in den Händen und im Hals. Offensichtlich sind ihre Resonanzfrequenzen heute im Einklang, denn sobald sie die Worte über Körperlichkeit ausgesprochen hat, greift Maggie im Gespräch zum Stift und macht sich Notizen. Sie habe so viel geschrieben und während der Uni „über diese Dinge nachgedacht”, da sei es interessant, durch Interviews verschiedene Erkenntnisse miteinander zu verknüpfen. Sie lerne vor allem durchs Reden, sagt Maggie. Was sie notiert, verrät sie nicht.
 Foto: S. Holden Jaffe (Del Water Gap)
Foto: S. Holden Jaffe (Del Water Gap)
„Surrender”: Triumph im offenen Raum
Gerade befinde sie sich in einem offenen, lockeren, freien Raum ihrer Karriere, fährt sie schließlich fort. Ihre alten Songs als Archiv-Album zu veröffentlichen habe den Cut zwischen den großen Karriere-Fragen und der jetzigen „Bonus-Zeit” geschaffen. Von hier an könne sie nur geradeaus gehen. „Surrender” ist trotzdem oder gerade deshalb ein so ein exzellentes und ausgezeichnet konzipiertes Album, denke ich. Wo sich Rogers bisheriges Werk oft anfühlte wie ein Coming-of-Age-Film, ein synästhetisches Bild zwischen Poesie und Demo-Tapes, New York trifft Alaska, ist „Surrender” die real gewordene Manifestation einer zeitlosen Künstlerin, die sich über Rockstar-Vergleiche und Popstar-Agenden hinwegsetzt. „Das Ganze hat auch mit Ambition zu tun”, erklärt Rogers. „Ich habe schon immer sehr klar ausgedrückt, dass ich Musik mein ganzes Leben lang machen wollen würde. Aber ich hätte mir niemals ausgemalt, dass es so aussieht. Alles, was ich jemals wollte, war eine Show im Bowery Ballroom in New York zu spielen, einem Club für 500 Zuschauer*innen. Ich halte es für erwähnenswert, dass der erste große Sprung von einem Raum mit 30 oder 40 Leuten zu einem Raum mit 500 Leuten ein gewaltiger ist.”
Viele Künstler*innen verwenden solche Sinnbilder, um die Ausmaße ihrer Karriere zu beschreiben. Die wenigsten aber haben diese Entwicklungen eben so (akademisch) analysiert wie Maggie Rogers. Wenn es um die Beziehung von Künstler*in und Fans ging, wollte sie untersuchen, wie diese Verbindung in Zukunft genutzt werden kann, um Menschen zusammenzubringen. „Wie kann sie benutzt werden, um Frieden zu finden?”, fragt Maggie mich und gleichzeitig niemanden direkt. „Wie kann sie Botschafterin von Frieden sein?”
„Ich hatte Tagträume darüber, bei einem Festival zu sein, bei denen mir das Wasser im Mund zusammenlief. Besonders Festivals im Vereinigten Königreich und Europa. Dort habe ich drei, vier der unprätentiösesten und frohesten Erfahrungen überhaupt gemacht.”
Nachgeben, aufgeben, sich der Hoffnung hingeben
Ein wenig gesunder Eigensinn dürfte auch eine Rolle dabei gespielt haben, dass Rogers die Perspektiven der Performerin und des Publikums heute neu betrachten kann. Den Wechsel zwischen ihren bisherigen Karrierephasen, hin zum neuen Sound, zur neuen Freiheit, führt sie auf eine innere Taubheit zurück, die sie wie so viele während der Pandemie verspürte. „To surrender”, zu Deutsch eigentlich „aufgeben, kapitulieren, nachgeben” kann auch bedeuten, sich hinzugeben, der Hoffnung zum Beispiel – so viel, wie Maggie Rogers eben nur kann. „Ich musste einfach daran glauben, dass wir zu Live-Musik zurückkehren würden, dass es diese Zeit wieder geben würde”, sagt sie. Man könnte auch formulieren: Rogers musste zurück zum „echten” Leben finden, zurück zur Körperlichkeit, zurück ins Publikum, um eine neue Grundlage für alles zu finden, von Musik bis zu ihren Studien. „Ich hatte Tagträume darüber, bei einem Festival zu sein, bei denen mir das Wasser im Mund zusammenlief”, erinnert die Künstlerin. „Besonders Festivals im Vereinigten Königreich und Europa. Dort habe ich drei, vier der unprätentiösesten und frohesten Erfahrungen überhaupt gemacht. In der Menge zu sein, ein Musik-Fan….ich wollte einfach eine Platte machen, die sich lebendig anfühlt. Musik zu machen, die ich körperlich spüren kann, war in dieser Zeit der Taubheit unglaublich heilsam.”
 Foto: Olivia Bee
Foto: Olivia Bee
28, Master-Absolventin, berufstätig
Maggie Rogers wird diese Musik im kommenden Herbst live spielen, wenn Europas Festival-Saison gerade zum Ende gekommen ist. Vielleicht weiß die Künstlerin dann noch mehr über den offenen, freien, lockeren Raum, in dem sie sich gerade befindet. „Life is a promise that never ends”, singt sie vorausschauend auf „Symphony”, einem weiteren Highlight-Track der neuen Platte. Maggie Rogers ist erfüllt von Dankbarkeit für ihren bisherigen Weg. Und dennoch weiß sie: „Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind verrückt, und es gibt solche, die einfach meinem Alter entsprechen. Manche meiner Freund*innen wurden zum Beispiel gerade 26 oder 27 und haben ihren Abschluss gemacht. Ich kehre nun auch ich in meinen Job zurück und habe den Eindruck, dass ich jetzt ein viel besseres Gefühl dafür habe, wie man ihn macht. Aber ich bin eben 28 – für dieses Alter fühlt sich das alles ziemlich passend an.” Auf meine Frage, ob sie denn noch eine ermutigende Anekdote – ich will es nicht Ratschlag nennen – für junge Menschen habe, die vor ähnlich offenen Lebens-Weichen stehen, schickt Maggie Rogers einen letzten Lyric ihres neuen Albums hinterher. Er stammt vom Song „Honey“ und er geht so: „Honey, if i knew, I would tell you.”
Hier findest du noch mehr Coverstorys, die deine Playlist inspirieren:
Das Selbstbewusstsein der Stillen: Little Simz in der Digital Cover Story
Über Zeit, Raum und den eigenen Kosmos: Musikerin Shygirl im Digital Cover Interview