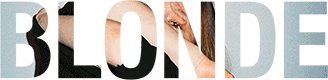Die Verfilmung über Prinzessin Diana mit Kristen Stewart in der Hauptrolle kommt morgen in die deutschen Kinos. Wir haben den Film vorab gesehen und finden: Das war nix. Warum, lest ihr hier. Achtung, Spoiler- & Triggerwarnung: In diesem Text geht es um Essstörungen und selbstverletzendes Verhalten.
Ein*e Zuschauer*in muss sich nicht für die Lebensgeschichte von Prinzessin Diana interessieren, um sich den Film „Spencer” anzusehen. Wer Popkultur oder Schlagzeilen in der Vergangenheit auch nur mit einem Auge verfolgt hat, dürfte genug über das allseits als „dramatisch” kategorisierte Leben der Princess of Wales wissen. Dieses Wissen dürfte wiederum ausreichen, um sich in all den Darstellungen von Diana, die gerade über die Bildschirme flackern, auf andere Dinge zu konzentrieren – auf Schauspiel zum Beispiel, Skript, auf die charakterlichen Nuancen einer der bekanntesten Personen unserer Zeit. Wer sich „Spencer” ansieht, muss aber auch kein*e Royal-Expert*in sein, um zu erkennen, dass dieser Film eher enttäuschend ist.
Ein (verspätetes) Fest mit der Royal Family
In anderen Ländern ist „Spencer” bereits in der Vorweihnachtszeit angelaufen und hat seitdem Kritiken und Feedback eingeheimst. Unter anderem gab’s jüngst eine Golden-Globe-Nominierung für Hauptdarstellerin Kristen Stewart. Es sah so aus, als würde der Film sie zusammen mit Lady Gaga zu einer der meistbesprochenen Darstellerinnen des letzten Filmjahres machen. Und zur Anwärterin für jene großen Awards – aber dazu später mehr. Dass der Film in der Weihnachtszeit anlief (hierzulande wurde sein Start mehrfach verschoben), hat aber nicht nur Award-technische Gründe. So erstreckt sich die Handlung über ein einziges Weihnachtswochenende mit der englischen Royal Family in den 90er-Jahren. Es ist ein Zeitpunkt, an dem Diana schon nicht mehr die vermeintlich schüchterne Newcomerin im Königshaus ist. Stattdessen ist sie frustriert, desillusioniert, gefangen in ihrer Ehe mit Prince Charles, in Verpflichtungen und Gerüchten.
Es wäre schön zu sagen, dass Stewart hier zur „Character Actress” wird, dass sie ihren eigenen Charme bewahrt und gleichzeitig Raum für die Figur lässt. All das schafft sie ein wenig.
 Da hilft auch kein Chanel-Kostüm: Kristens Stewarts erster Auftritt als Diana.
Da hilft auch kein Chanel-Kostüm: Kristens Stewarts erster Auftritt als Diana.
Foto: Pablo Larraín, DCM/Presse
Das Beste sind die Bilder
Über den Verlauf von zwei Stunden sollen Zuschauer*innen viele Facetten von Diana sehen, vor allem aber geht es um jene Frustration, Desillusionierung, die Gefühle von Isolation. Inszeniert werden sie in Aufnahmen, die das beste Element von „Spencer” sind. Die Bilder sind stark, die Cinematografie genau so pompös und gleichzeitig geisterhaft, wie es Dianas öffentliches Bild vorgibt. Der sonstige Hang zur Dramatik und die vielen theatralischen Momente des Films könnten zu der Vermutung führen, der Film wäre ein US-amerikanisierter Blick auf die Geschichte Dianas. Pablo Larraín, der Regisseur, ist allerdings Chilene; das Skript stammt vom englischen Drehbuchautor Steven Knight. Die sonstige Produktion erfolgte vor allem aus der Hand von englisch-deutschen Teams. Gefilmt wurde unter anderem im Schloss Nordkirchen im deutschen Münsterland und dem Schlosshotel Kronenberg im Taunus. Das Setdesign hier kann sich sehen lassen: Die beeindruckenden, einschüchternden und absurden Royal-Vibes sind in jedem Moment präsent. Sie leben von den großen – wenn auch vielen – Aufnahmen von weiten Parks, Landschaften und Schlossanlagen. Selbst die weiten Winkel der Badezimmer, in denen Diana zusammenbricht, stinken dagegen nicht ab.
Weite Winkel: Das beste an „Spencer” sind seine Bilder. Foto: Pablo Larraín, DCM/Presse
Womit wir bei Stewarts Darstellung der Prinzessin wären. Es wäre absolut zu wünschen, dass Kristens Verkörperung der Figur ein voller Erfolg wäre. Von einigen Kritiker*innen wird sie dafür auch gefeiert – zum Teil so sehr, dass der gesamte Film erschöpfend nach „Oscar-Köder“ klingt. Im Gegensatz dazu wirkt die Anfangssequenz von „Spencer“, in der Diana in einem Café nach dem Weg fragt, aber mehr wie ein Sketch aus Saturday Night Live – da hilft auch das Chanel-Kostüm nicht. Zum Glück legt sich dieser Eindruck im Verlauf des Films. Die Herausforderung der Rolle aber bleibt groß und mit ihr der Druck, eine neue Facette zum etablierten Bild von Diana hinzuzufügen. Es wäre schön zu sagen, dass Stewart hier zur „Character Actress” wird, dass sie ihren eigenen Charme bewahrt und gleichzeitig Raum für die Figur lässt. All das schafft sie ein wenig. Noch mehr als in vielen anderen „Biopics” scheint sie aber in absolut jeder Sekunde des Films zu sehen und kann diese Über-Anwesenheit nicht für volle zwei Stunden tragen.
Der einzige Moment, in dem Dianas Bulimie anders dargestellt wird, ist der, in dem „Spencer“ kurz zu einem surrealistischen Film werden könnte: Beim abendlichen Bankett findet Diana die Perlen ihrer Halskette in ihrer Suppe und zerkaut sie unter lautem Knacken. Szenen wie diese bleiben im Skript jedoch einsam.
Natürlich ist es wie so oft unfair, Stewarts Darstellung mit der von Emma Corrin als Diana in „The Crown” zu vergleichen. Auch mit der von Elizabeth Debicki, die in der Serien-Rolle ab Herbst 2022 zu sehen sein wird. Wenn diese Vergleiche aber auftauchen, haben sie ausnahmsweise vielleicht mal weniger mit der sexistischen medialen Anstachelung von Hauptdarstellerinnen gegeneinander zu tun. Vielmehr sind sie das Ergebnis des ewigen Diana-Kults, der sich seit fünf bis zehn Jahren definitiv einer neuen Welle erfreut. Und wo wir schon bei Vergleichen sind: Vor wenigen Jahren führte Pablo Larraín mit „Jackie” bei einem weiteren Lebens-Epos Regie. Der Film begleitet die US-amerikanische First Lady Jackie Kennedy während der drei Tage, in denen ihr Mann ermordet wird. Dieser Film – vielleicht soll das eine Hommage an die jeweiligen Charaktere Jackie und Diana sein – war ruhiger, weniger theatralisch. „Spencer” aber wirkt manchmal wie ein altes Bühnenschauspiel, das versehentlich mit der Kamera aufgenommen wurde: Dramatische Szenen und Gesten sind überzeichnet, sodass auch Zuschauer*innen in der letzten Reihe sehen sollen, wie verzweifelt Diana ist.
Könnte kurz zum surrealen Element werden: Dianas Perlenkette.
Foto: Pablo Larraín, DCM/Presse
Achtung, Kitsch-Keule! Von Perlenketten und wilden Halluzination
Als Werkzeug dafür dient zum Beispiel ihre Bulimie. Auch wenn solch eine Erfahrung nicht in jedem Werk groß kontextualisiert werden muss, ergibt es sich in diesem Film leicht: Dianas Verhalten steht im Kontrast zum Ritual der Queen, die alle Gäst*innen bei An- und Abreise im Schloss wiegen lässt. Damit will sie zu überprüfen, ob sie über die Feiertage genügend Essen (= „Spaß”) hatten. Trotzdem wirken die Szenen, in denen Diana sich übergibt, in ihrer schlichten Anzahl wie ein „plumpes” Werkzeug für mehr Drama. Gleiches gilt für den Moment, in dem sich die Princess of Wales mit einer Schere absichtlich selbst verletzt (für den Film wäre auch über Triggerwarnungen nachzudenken). Der einzige Moment, in dem die Essstörung anders dargestellt wird, ist der, in dem „Spencer“ kurz zu einem surrealistischen Film werden könnte: Beim abendlichen Bankett findet Diana die Perlen ihrer Halskette in ihrer Suppe und zerkaut sie unter lautem Knacken. Szenen wie diese bleiben im Skript jedoch einsam. Stattdessen gibt es absurde und unnötige Kitsch-Metaphern. Allen voran diese: Diana liest die Biografie der vor Jahrhunderten hingerichteten Anne Boleyn. Ihr soll sie sich offenbar so verbunden fühlen, dass sie Diana sogar als Halluzination in den Schlossfluren erscheint, wo beide miteinander sprechen. Das tut für die Handlung ebenso wenig wie Dianas ernstes Gespräch mit einem Fasan (?!) oder ihre weitere Halluzination einer vertrauten Angestellten, die aus dem Schloss abgereist ist. In diesen Momenten wird aus der „Spencer”-Storyline ein fransiges Klischee-Gespenst.
 Der Billardtisch ist 2022 der Ort im Film, an dem die Schicksale der Superreichen entschieden werden. Foto: Pablo Larraín, DCM/Presse
Der Billardtisch ist 2022 der Ort im Film, an dem die Schicksale der Superreichen entschieden werden. Foto: Pablo Larraín, DCM/Presse
Kann dieser Film die Kugel ins Rollen bringen?
Die tatsächlich bewegende Szene ist eine andere: Sie zeigt Diana beim mehr oder weniger einzigen Gespräch, das sie im Film mit ihrem Mann Charles führt. Auch hier geht es um eine bereits bekannte Facette der Princess of Hearts – die von ihr als beschützende Mutter. Dianas Zwiespalt zwischen Selbstbestimmung und inner Zerstörung wird in keiner anderen Szene so deutlich. Am Ende ließe sich aus der Szene aber noch etwas anderes ableiten: Die Schlüsselmomente eines Films spielen sich offensichtlich neuerdings am Billardtisch ab. Das war schon in Lady Gagas Darstellung von Patrizia Reggiani in „House of Gucci” zu sehen, als diese am Billardtisch kurz Einblick in die absolute Verzweiflung ihrer Figur gibt (hier zu lesen bei unserem Sister-Mag NYLON Germany). Auch Diana und Charles diskutieren in „Spencer” am Billardtisch. Und vielleicht ist dieser Tisch ein weiteres unter den Bildern, als Metapher für die Leben und Leiden der Superreichen winken sollen. In Szenen wie diesen dient der Billardtisch nicht als Sportstätte oder Ort für dumme Sprüche in düsteren Bars, sondern als Symbol einer elitären Vorstellung von Spaß und Sieg. Um die zu erreichen, muss Mensch eben nur die richtige Kugel anschieben. Dafür braucht es bekanntlich ein bestimmtes Werkzeug, den Stab, genannt „Queue”. Und wenn Zuschauer*innen aus „Spencer” nur eine bedeutungsschwangere Metapher mitnehmen, dann diese: Warum hat Diana nie gespielt? Weil an ihrem Billardtisch nur Kugeln lagen – aber niemals die passenden Werkzeuge.
Alternativen für die Watchlist gibt’s hier:
Indie-Film, Mini-Serie, Liebesdrama: 10 Streaming Tipps, die immer passen
5 Serien über Familien, die nichts mit Verwandtschaft zu tun haben
Heat Me Up: Vier Frauen über Pornos und ihre filmischen Vorlieben