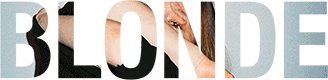Während viele gerade darüber sprechen, was wir nun wie schnell nachholen, ist unser*e Autor*in überfordert von anderen Gedanken: Wie gehe ich damit um, wenn ich bei der Rückkehr ins Social Life schnell vergesse, was ich in den letzten Monaten erlebt habe?
Gerade fahre ich zu einer Feier – einer „Versammlung”, wie man in offiziellen Dokumenten sagen würde. Dort werde ich so viele Menschen treffen wie seit dem letzten Spätsommer nicht mehr. Vielleicht waren es damals sogar weniger. Aus dieser Perspektive betrachtet wäre die bevorstehende Situation die erste vergleichbare seit anderthalb Jahren. Fast, denn: Vor ein paar Tagen war ich bereits auf einem Geburtstag in kleiner Runde, legal, draußen, mit Test und Abstand. Das war eine der ersten Einstimmungen auf das, was gerade viele erleben: mehr Menschen, mehr Möglichkeiten, ein wiedererwecktes Social Life. Mir war im Vorfeld ein wenig mulmig zumute. Die letzten Monate hatte ich außerhalb der Familie selten mehr als eine Person auf einmal gesehen – würde ich mich hier trotz Test und Co entspannen können? Könnte ich meine Social Skills auch in Gruppen wieder reaktivieren? Turns out: Ich kann. Das überrascht mich, aber auch nicht. Nicht immer die Pandemie vor Augen haben zu können, ist erleichternd. Aber es verwirrt mich manchmal, wenn wir jetzt wieder zusammensitzen, und sich bei physischer Nähe, Gesprächen oder gemeinsamen Gruppen-Aktivitäten alles direkt anfühlt, als hätten wir in der Zwischenzeit problemlos Dornröschenschlaf gemacht, der jetzt keine Rolle mehr spielt.
Wie naiv sind Erwartungen an Veränderungen?
Vielleicht bin ich so etwas wie eine Durschnittsperson der Pandemie: Wie essentiell meine sozialen Verbindungen sind, ist auch mir in dieser Zeit bewusst geworden. Trotzdem hatte ich, wie ebenso viele, nun mal den Luxus, über das Ende von FOMO zu sinnieren und mich an einigen Stellen darüber zu freuen, dass sie uns verlassen hat.
Wie gesagt, ich gönne jeder*jedem die Rückkehr zu sozialen Kontakten, Plänen, Events und der damit verbundenen Freude – bei mir ist sie ja auch da. Irgendwie ist es aber ein gefühlstechnisches Chaos, meine Wahrnehmung dieser Rückkehr zu formulieren und sie mit vielen Perspektiven der Außenwelt zu vereinen. Das könnte auch daran liegen, dass gerade viele über die kommenden Momente des Sommers sprechen und schreiben, zum Beispiel eben über neu entstehenden sozialen Stress, der ein Post-Corona-Burnout bescheren könnte und auch Menschen mit psychischen Krankheiten oder sozialen Ängsten vor Schwierigkeiten stellt. Das New York Magazine widmet der Rückkehr von FOMO eine Titelgeschichte – über das Ausbleiben genau dieser Angst hatte zum Beispiel auch ich mich gefreut. Ein Soziologe spricht in der taz ausführlich darüber, warum wir trotz vermeintlicher Entschleunigung ruhelos sind, Podcasts besprechen, wie man die Rückkehr ungewollter Treffen am besten vermeidet. In meinem privaten Umfeld gibt es Beispiele für beide Perspektiven: Menschen, die seit Wochen wieder in den Urlaub fahren und solche, die schon beim Anblick von vollen Cafés und aktiven Insta-Storys nervös werden. Ich stehe irgendwo dazwischen.
Durschnittsperson der Pandemie
Wie viele habe ich zahlreiche Privilegien genossen, von einem erhaltenen Arbeitsplatz in einem nicht-systemrelevanten Job, über Home Office bis zu medizinischer Versorgung und meiner eigenen Wohnung. Rein faktisch gab es also allein auf der sozialen Ebene Einschnitte. Und in dieser Hinsicht bin ich vielleicht so etwas wie eine Durschnittsperson der Pandemie: Wie essentiell meine sozialen Verbindungen sind, ist mir in dieser Zeit erneut bewusst geworden, big surprise. Auch deshalb freue ich mich, in Sachen Interaktion wieder mehr Möglichkeiten zu haben. Trotzdem hatte ich, wie ebenso viele, nun mal den Luxus, über das Ende von FOMO zu sinnieren und mich an einigen Stellen darüber zu freuen, dass uns mit ihr zum Beispiel awkarder Smalltalk oder unliebsame Netzwerk-Events verlassen haben. Aber auch, wenn ich bei dem Gedanken daran Bauchschmerzen habe, werde ich mich diesen Situationen nicht immer entziehen können.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Was werfen wir gerade über Bord?
Vermutlich werde ich also auch dann überrascht sein – davon, wie in den wenigen, größeren sozialen Happenings, die ich gerade erlebe, zum Beispiel in Gesprächsthemen oder körperliche Nähe keine Veränderung zu erkennen ist und einige direkt wieder in schnelle soziale Gefühe und Reaktionen einsteigen können. Zumindest während des Geschehen – mir persönlich wird meine echte Wahrnehmung der Situation oft erst im Nachhinein ganz klar. Von AHA-Regeln aber mal abgesehen: Würde man uns aus einer Situation rausbeamen, manchmal könnten wir aus der Vogelperspektive nicht sagen, ob wir uns gerade bei einer Versammlung pre– oder post-COVID befinden. Das ist beruhigend. Manchmal beschleicht mich danach aber die Sorge, dass die Euphorie und der Optimismus trügerisch sind. Ich will weitermachen. Aber lauert in diesem Coping Mechanism nicht die Gefahr, das (nicht) Erlebte zu schnell über Bord zu werfen?
Vielleicht bin ich nur unvorbereitet
Menschen haben ihre Existenzen und Angehörige verloren, Verluste erlitten, sind an Depressionen erkrankt und mussten sich an viele Dinge gewöhnen. Wir könnten doch bei aller Freude und Erleichterung also zum Beispiel trotzdem nachhaltiger anerkennen, was die Struggles, zum Beispiel mit mentaler Gesundheit, im Einzelnen für sie bedeutet haben – war es Einsamkeit oder Überforderung durch Fürsorge für andere? Welche Konzepte der eigenen Lebensgestaltung hat man vielleicht infrage gestellt? Für mich könnte das alles koexistieren. Wir könnten uns wieder vereinigen, ohne so zu tun, als hätten wir uns erst gestern gesehen, auch wenn das schön ist. Statt ganz normal darüber zu Reden, was denn gerade so bei der Arbeit los ist, könnte man darüber sprechen, ob sich unsere Einstellung zu Arbeit in der letzten Zeit verändert hat. Zugeben, wenn man Zeit braucht, sich an die Rück-Veränderung zu gewöhnen. Mir persönlich gäbe so etwas das Gefühl, nach der langen Zeit des Social Distancing auch emotional wirklich wieder näher beieinander zu sein und dieselbe Zeit durchlebt zu haben. Aber es überfordert aber auch mich, bei einem einfachen Treffen all das zu bedenken und Perspektiven gerecht zu werden. Vielleicht fühle ich mich jetzt, wo sich ein Neustart anbahnt, einfach unvorbereitet.
Man kann das alles durchaus furchtbar naiv nennen. Aber dass wir unsere Interaktion um 180 Grad drehen, habe ich nie geglaubt.
In diesen Momenten treten also Fragen auf, was es braucht, damit die Pandemie im Bewusstsein bleibt, aber nicht immer an der vordersten Gedankenfront. Konkret: Fühlt es sich wirklich komisch an, wenn in der größeren Freund*innenrunde manchmal alles genauso wirkt wie 2019? Ist erleichternd oder bedrückend, kann ich mich einfach freuen? Ist es unnötig, darüber zu sinnieren? Soll ich mich dem Übergang zur Erfüllung meiner Bedürfnisse und der Euphorie anderer hingeben oder sie eher abwehren, wie es wieder andere tun würden? Kann ich mich auf meine Intuition verlassen? Warum erwarte ich überhaupt, dass sich Dinge verändert hätten?
Gerade letzteres kann man durchaus für furchtbar naiv halten. Aber daran, dass wir unsere Interaktion zueinander um 180 Grad drehen, habe ich nie geglaubt. Mir geht es bei diesen imaginierten Veränderungen auch nicht nicht um romantisch-verklärte Bilder, in denen wir denken, dass von nun an alles anders wird. Bei aller Freude müssen wir aber müssen wir ja aber nicht sofort zu all denselben Standards zurückkehren.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Den Widerspruch anerkennen
Achtung, Enttäuschung: Eine klarere Antwort auf all diese Fragen habe ich nicht. Im Umgang mit der Erinnerung an die Pandemie geht es für viele in erster Linie ja darum, an diejenigen zu erinnern, die sie ihr Leben gekostet hat oder die Angehörige verloren haben. Genauso gilt es, aktiv diejenigen zu unterstützen, die den Großteil der Auswirkungen auf ihren Schultern tragen. Das ist natürlich richtig, aber im ganz persönlichen Kontext längst nicht immer leicht, weil die Erfahrungen und Kapazitäten einer*eines einzelnen vielseitig und unterschiedlich sind und sich verändern können – so auch meine. In diesem Kontext muss sich also niemand dazu zwingen, an bestimmte Punkte der letzten Monate zu denken, wenn er*sie es gerade nicht fühlt. Genauso wenig müssen wir diese Gedanken aber verdrängen. Deshalb tut es zumindest mir manchmal gut, all die obigen Fragen in Erinnerung zu rufen, um die Gegenwart besser zu verstehen und mit Veränderungen – sollten sie denn auftreten – besser umzugehen. Zu merken, dass das, was kommt, irgendwie anders ist. Das scheint vielleicht anfänglich schwierig, wenn Situationen entstehen, in denen ich offensichtlich dazu neige, das „Verpasste“ überzukompensieren. Ich bin mir aber sicher, dass mir die Gedanken, in denen das Hier und Jetzt kurz befremdlich erscheint, auch noch in späteren Phasen kommen werden. Und diesen Widerspruch im Verhalten anzuerkennen, mit ihm umzugehen und vor allem eine eigene Bewertung dafür zu finden, braucht es vermutlich das, woran ich in den letzten 14 Monaten versucht habe zu arbeiten: Geduld.
Dieser Text wurde anonym veröffentlicht. Es wurden kleine Korrekturen vorgenommen.
Mehr Denkanstöße könnt ihr hier nachlesen:
Panikattacke & Angststörung: Kann eine Smartphone-App die Therapie ersetzen?
„Auf Ritalin mache ich nur meine Steuererklärung”: 10 Frauen sprechen über AD(H)S
Gönn dir Stille: Warum wir schweigen und uns doch nicht dem Gespräch entziehen