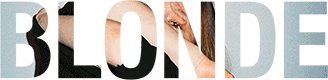Was passiert eigentlich, wenn wir uns verändern? Diese Frage haben wir Autorin Ilona Hartmann, Musiker*in Lie Ning und Galeristin Anahita Sadighi gestellt. Ihre sehr unterschiedlichen Antworten lest ihr hier!
„Ich wollte wirklich gerne meine Jugend verschwenden, aber doch nicht so“, heißt es in Ilona Hartmanns Roman Klarkommen. Wenn sie nicht gerade auf Instagram Brat Color codet oder Bücher schreibt, teilt sie humorvolle Alltagsbeobachtungen und Outfit-Inspos. Für die aktuelle Ausgabe der BLONDE, hat sich die Autorin die Zeit genommen, darüber zu philosophieren, was Veränderung, oder der Umgang damit, in ihr auslöst.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ilona Hartmann: Was passiert, wenn wir uns verändern?
Neulich haben sie bei meinem Lieblingsjoghurt das Verpackungsdesign geändert. Das war schrecklich. Es sieht jetzt besser aus als vorher, aber trotzdem. Und so ist es ja oft: Selbst wenn die Veränderung mit etwas Abstand betrachtet ausschließlich von Vorteil war, ist da am Anfang immer ein leiser innerer Widerstand. Was soll denn das? Warum konnte das nicht so bleiben wie vorher? Gebt mir mein altes Design zurück! Eigentlich wäre ich gerne eine Person, die sich mit Veränderung leichttut. Sie freudig begrüßt und Leuten was erzählt von dem holprigen Anfang, nach dem es dann aber ganz leicht ging. Warum geht es nicht leicht?
Ich kenne viele Menschen, die Veränderung mindestens anstrengend finden, nicht ohne sich dabei ein wenig zu schämen und damit ein bisschen spießiger zu wirken, als ihnen lieb ist. Verantwortlich dafür ist zum einen das menschliche Gehirn, das energiesparende Routinen liebt. Wir machen alles wie immer! Das ist ungelogen so angenehm. Und ehrlich gesagt, unser Leben im Spätkapitalismus lässt zwischen allen Anforderungen und äußeren Zwängen oft nur minimale Zeit und Kraft, sich an etwas Neues zu gewöhnen oder, noch schlimmer, nachhaltig das eigene Verhalten zu verändern. Sobald man es versucht, hat man Leute im Feed, die einem sagen, man solle den „Change embracen“ und überhaupt sei Life ausschließlich Change und so weiter. Meistens soll man ihnen dann folgen für noch mehr lebensverändernde Weisheiten oder ihren Sechswochenkurs buchen.
Eigentlich wäre ich gerne eine Person, die sich mit Veränderung leichttut.
Veränderung wird meistens als Optimierung „geframt“ und meistens ist die auch irgendwie teurer als der Zustand davor. Eine gewisse Skepsis gegenüber Veränderungs-Fans ist also gar nicht so schlecht. Zumindest, sofern sie hilft zu unterscheiden, wer etwas verkaufen will und wer tatsächlich echte Weiterentwicklung anzubieten hat. Und es gibt ja auch durchaus Veränderungen, bei denen Skepsis nicht ausreicht, sondern die vehementen und ausdauernden Widerstand erfordern. Die Alternative wäre, jemand zu werden, der früher alles besser fand. Zum Beispiel die vielen kleinen Blaubeeren auf dem Joghurtbecher statt der einen großen, na ja. Früher hat sich nämlich nicht so viel geändert. Denkt man zumindest später. Damit würde ich aber erst im letzten Lebensabschnitt anfangen, wenn überhaupt.
Das eigentliche Problem mit Veränderung ist, dass der interessanteste Teil davon nicht das Davor oder Danach ist, sondern das Dazwischen. Sich zu beobachten beim Anpassen, Üben, der Selbstüberwindung und Selbsterweiterung, das ist ein lebendiger Zustand. Ich glaube, man muss sich nicht nur mit Veränderungen anfreunden, sondern vor allem mit dem Hadern damit. Nach vorne straucheln, gracefully. Leider nicht immer angenehm. Was hilft? Keine Ahnung. Wenn ich es besser wüsste, hätte ich mich mit dem Joghurt ja nicht so angestellt. Oder ich würde einen sechswöchigen Kurs für sehr viel Geld anbieten.
Headerbild: Lenny Rothenberg
Mehr zum Thema Veränderung findet ihr hier:
Warum wir eine Coming of Age-Serie wie „Schwarze Früchte“ dringend brauchten
Echoes of Change: Model und Künstlerin Anuthida und ihre Rolle als Mutter
Filmtipps für den Herbst: Diese 8 Filme eröffnen neue Perspektiven