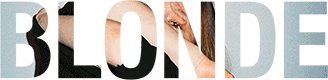Wie sieht die reale Lebenswelt der Frauen aus, denen ihr Abtreibungswunsch verwehrt bleibt? Drei Frauen schildern ihre Erfahrungen.
Im August 2018 berichtete blonde von Frauen, die abgetrieben haben und ihre persönliche Geschichte erzählen. Sie alle haben sich aus den unterschiedlichsten Gründen gegen ein Kind entschieden: Unzuverlässige Berghain-Daddys, Gewissensduschen von Freundinnen, kein Job, kein Geld, keine Perspektive – oder schlichtweg (noch) nicht bereit, Mutter zu werden. Die Wahl gegen das Kind aus persönlichen Gründen muss okay sein. Seit fast vierzig Jahren gehört diese Entscheidungsfreiheit immerhin zu den großen Erfolgen im Kampf um das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Es handelt sich aber um ein Recht mit Grenzen – und das ist vielen immer noch nicht bewusst. Erst im letzten Jahr (Stand dieses Beitrags: 29. Januar 2019) wird eine Frauenärztin verurteilt, weil sie auf ihrer Website über Schwangerschaftsabbrüche informierte. Das Ergebnis des Abtreibungsparagraphen 219a. Das macht wütend und holt uns alle wieder auf die Straße. Hier geht es schließlich um unsere persönliche und körperliche Freiheit. Aber ist die Parole „My Body, My Choice” vielleicht doch nur eine feministische Utopie? Denn was ist, wenn wir nicht selber über unseren Körper entscheiden können und Paragraphen, Ärzte, Angehörige, Fristen oder Religionen uns unsere Entscheidungsfreiheit nehmen?
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 29. Januar 2019 veröffentlicht. Der Einfachheit halber sprechen wir hier allgemein von Frauen, möchten aber betonen, dass genauso junge Mädchen und Menschen mit queerer, non-binary und trans* Geschlechteridentität schwanger werden können.
Nach einer kurzen Aufarbeitung der Widerstände, denen das weibliche Selbstbestimmungsrecht in Bezug auf Abtreibungen ausgesetzt ist, tauchen wir ein in die reale Lebenswelt hinter §219a und lassen drei junge Frauen von ihren persönlichen Erfahrungen berichten.
Gerade gestern wurde ein Referentenentwurf veröffentlicht, mit dem die Regierung scheinbar einen Schritt auf die Abtreibungsbefürworter zugehen will. Die Werbung für Abtreibungseingriffe ist zwar nach wie vor verboten, aber der Paragraph 219a wurde ergänzt. In Zukunft dürfen Arztpraxen und Kliniken darüber informieren, dass sie den Schwangerschaftsabbruch anbieten. Aber ist das genug?
Scham, mangelnde Information durch den Abtreibungsparagraph und unkooperative Weißkittel: Die Hürden sind groß
Die Bedingungen, unter denen Frauen noch vor fast 50 Jahren abtreiben mussten, sind mit der heutigen Situation zum Glück nicht mehr vergleichbar: Damals fanden Abbrüche grundsätzlich im Verborgenen statt, ob im Ausland, mit der “Kleiderbügeltechnik” oder für viel Geld in dreckigen Kellern von zwielichten Weißkitteln. Dennoch bleiben Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland grundsätzlich verboten und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei: ausschließlich vor der 12. Schwangerschaftswoche (auch nach einer Vergewaltigung), lediglich von einer/m praktizierenden Ärztin/Arzt und auch nur mit voriger Beratung und Genehmigung durch eine staatlich anerkannte Konfliktberatungsstelle. Klingt aufwändig? Ja, das ist Deutschland: Die Bürokratie schläft nie. Und bereits der Weg zu einer solchen Beratung kann eine entscheidende Hürde darstellen. Gründe dafür sind nicht nur die eigene Angst und Scham – denn das Thema ist bekanntlich intim, gesellschaftlich tabuisiert und durch kontroverse Debatten belastet – sondern auch die mangelnden Informationsmöglichkeiten. Dafür ist der heiß debattierte Twitter-Hit §219a mitverantwortlich. Der Paragraph, der Information und Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt, lockt nicht nur auf politischer, sondern vor allem auf gesellschaftlicher Ebene so manchen „Lebensschützer*in“ aus dem Loch:
„Hoffentlich tritt dir bald mal jemand solange in deine widerliche Semiten-Hackfresse, bis sich dein Hirn auf dem Boden verteilt“. Diese dümmliche Botschaft ist eine der zahlreichen Hass- und Drohnachrichten, die die Frauenärztin Dr. Kristina Hänel 2017 bekommt, nachdem sie sich wegen des Verstoßes gegen den §219a strafbar macht und angezeigt wird. Der Fall löst eine alte Debatte neu aus und §219a wird zur Schlagzahl einer überaus komplexen Problematik. Viele Frauen fühlen sich wieder in der Substanz ihrer seit den 1968ern errungenen Selbstermächtigung angegriffen. Das kitzelt an den überwiegend eingeschlafenen Füßen des deutschen Feminismus. Der Kleiderbügel wird zum Symbol der wiederbelebten Protestbewegung.
Initiativen wie #keineKompromisse und Pro-Choice fordern: Vergesst nicht die Umstände, unter denen so manche Kinder aufwachsen würden!
Unter dem Hashtag #keinekompromisse fordern Frauen sowie Männer der Pro-Choice-Bewegung die Abschaffung des Paragraphen. Unter dem gleichen Hashtag kontern auch die selbsternannten “Lebensschützer*innen” mit umstrittenen Anti-Abtreibungsparolen. Vor allem streng-religiöse oder konservativ bigotte Stimmen proklamieren die Zerstörung von Familie und Gesellschaft durch Abtreibung: Die nicht-werden-wollende Mutter wird an den Ethik-Pranger gestellt, von dem sie nur über die Entscheidung für die Geburt erlöst werden kann. Im umgekehrten (selbstbestimmten) Fall bleibt sie dort – von den „Lebensschützer*innen“ als Kindsmörderin deklariert. Dabei wird lediglich gegen den vorsätzlichen Mord des ungeborenen Lebens (als autonomes Wesen im Mutterleib) argumentiert. Unter welchen Umständen das Kind später aufwächst – innerhalb sozialpolitischer Strukturen, die mittellose Single-Mütter immer noch benachteiligen – wird unter den Abtreibungsgegnern weder auf gesellschaftlicher noch auf politischer Ebene diskutiert.
Dieser lückenhaften Reflektion entspricht in der sozialen Realität ein mangelhafter Informationsstandard: Es gibt wenig hilfreiche Informationsquellen im Internet und noch weniger kompetente Hilfe im realen Umfeld ungewollt schwangerer Frauen. Das ist auch dem Abtreibungsparagraphen geschuldet. Viele stoßen bereits bei der Google Suche auf fragwürdige Informationsseiten oben genannter Abtreibungsgegner.

Ende 2019 wir der fordernde Hashtag #keinekompromisse erfolgreich ignoriert. Die Koalition einigt sich auf einen “Kompromiss“ im Streit um den Abtreibungsparagraphen §219a, der nun verabschiedet wurde. Dieser “Informationskompromiss” erlaubt Ärzt*innen nunmehr, Schwangerschaftsabbrüche in ihr Angebot aufzunehmen, verbietet aber weiterhin jede Form von Werbung dafür. Auch Details über die Vorgehensweise und Methoden dürfen nicht aufgeführt werden. Dahinter steckt neben einem gewachsenen Misstrauen gegenüber Ärzt*innen auch das verfestigte Bild leicht zu beeinflussender Frauen. Ob dieser Kompromiss zukünftig helfen kann, bleibt stark zu bezweifeln. Das Problem wird dadurch noch lange nicht in seiner Substanz eliminiert. Und solange Politikerinnen wie die Bundestagsabgeordnete Silke Launert noch Sätze raushauen wie diesen: “Wir haben im Moment eine Gesellschaft, wo wir die Werbung von Tabak verbieten wollen, aber die Werbung […] vom Abbruch der Schwangerschaft wollen wir jetzt wieder legalisieren. Das verstehe, wer will.”, solange läuft einiges schief – nicht nur grammatikalisch. Liebe Frau Launert, unseretwegen können Sie sich gerne ihren Körper mit 30 Zigaretten am Tag ruinieren. Es ist ja immerhin Ihr Körper. Go for it!
Zurück zum Wesentlichen: Hinter der aktuellen Rechtslage rund um den Abtreibungsparagraphen scheinen eher fadenscheinige Vorwände sowie der starre, veraltete Dogmatismus einer familienorientierten Sparkassen-Gesellschaft zu stecken. Frauen und ihre ungeborenen Kinder werden dabei getrennt betrachtet – die Frau als unmündige Brutmaschine und das Ungeborene als schützenswertes Gemeinschaftsgut. Das klingt nach der Dystopie in The Handmaid’s Tale? Theoretisch. Wir von BLONDE sind uns da einig: 1933 ist vorbei. In einem modernen Rechtsstaat sollte sich eine Frau dieser Veränderung ihres Körpers frei und unabhängig annehmen dürfen – ob in liebevoller Erwartung auf ihr Kind oder in verantwortungsbewusster Entscheidung dagegen. In beiden Fällen muss es leicht zugängliche, sachliche Informationen sowie auf Nachfrage kompetente und vor allem neutrale Beratung und letztendlich genügend Ärztinnen und Ärzte geben, die eine entsprechende Behandlung anbieten. Das alle ohne Zwang, Gewalt und Diskriminierung.
Am Ende geht es nicht um Moral, sondern um Recht
Aber ja: über Abtreibung zu sprechen, bleibt ein mühevoller Diskurs – und Abtreibung als Selbstbestimmungsrecht der Frau aus diesem Diskurs zu emanzipieren, ist demnach ein nicht weniger mühsames Unterfangen. In Zeiten eines Feminismus-Trends mit glitzernden „FEMINIST“-Shirts scheint das “blutige”, “schmutzige” und intime Thema störend und unangenehm. Doch ungeachtet jeder bigotten Moral, muss der Kampf für unser Recht stattfinden, denn ein Kampf für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen lohnt sich. Am Ende geht es hier nämlich um Recht und nicht um Moral. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch als Teil der sexuellen und reproduktiven Rechte der Frau ist ein Menschenrecht an sich. Das hat die UNO erst vor wenigen Jahren bestätigt und betont, dass dieses Recht überall gelten muss. (Das stellt also nicht nur einen weißen Feminismus vor Herausforderungen, sondern den intersektionalen.) Es muss darüber gesprochen, gestritten und berichtet werden – gemeinsam und überall.
Deshalb: Gerne zwischendurch mal das Glitzershirt ausziehen (oder auch nicht) und wütend weiter dafür kämpfen, wenn es darum geht: „My Body, My Choice, My RIGHT.“ Und bitte nicht falsch verstehen: Wir lieben Kinder – und wir freuen uns sehr, wenn sie in eine freie, selbstbestimmte und gerechte Welt geboren werden – auch ohne strengen Abtreibungsparagraphen.

Drei Frauen berichten, welche Hürden sie nach ihrer Entscheidung gegen ihre Schwangerschaft auf sich nehmen müssen:
Hannah, 27*
Bei der Beratung sprach nichts gegen das Kind. Außer mir. Das reichte anscheinend nicht. Mein Gegenüber war regelrecht sauer.
Mit Anfang 20 wurde ich unverhofft schwanger. Es war absurd, da ich regelmäßig und penibel genau die Pille genommen hatte. Ich merkte es damals auch erst in der zehnten Woche. Meine Periode hatte ich durch einen Pillenwechsel fünf Monate vorher sehr unregelmäßig bekommen, weshalb ich mich zwar wunderte, aber nicht auf die Idee kam, schwanger zu sein. Erst als meine Brüste deutlich wuchsen und mir immer wieder übel war, holte ich mir einen Test. Schwanger. Ich kaufte direkt noch einen Test. Immer noch schwanger. Am nächsten Tag fuhr ich in ein Nachbardorf in Niedersachsen zu meiner Frauenärztin. Sie testete mich erneut und diagnostizierte mir die Schwangerschaft in der 10. Woche (12. Woche nach meiner letzten Periode). Ich war völlig fertig. Ein Kind passte nicht in mein Leben. Ich wollte auch keine Kinder bekommen. Noch nie. Ich sagte meiner Ärztin, dass ich es nicht behalten wolle. Sie lachte und sagte, das könne ich leider nicht so einfach entscheiden. Erst müsse ich zu einer Beratung gehen und dann müsse eine entsprechende Ärztin oder Arzt den Abbruch durchführen. Auf meine Frage, ob sie das dann machen könne, schüttelte sie lachend den Kopf und sagte: „Ich mache sowas Schreckliches gar nicht. Ich beglückwünsche Sie jetzt erstmal zu Ihrem Baby, Frau K., andere Frauen würden hier jetzt mit Freudentränen sitzen.“
Ich bekam das Go – widerwillig
Ein Gefühl von Unbehagen machte sich breit, als ich nach Hause fuhr. Am nächsten Tag wollte ich einen Beratungstermin ausmachen. Es gab eine Beratungsstelle in der nächst größeren Stadt, bei der ich nach dem Wochenende fünf Tage später einen Termin bekam. Da war ich nun in der 11. Woche. Bei der Beratung sprach nichts gegen das Kind. Außer mir. Das reichte anscheinend nicht. Mein Gegenüber war regelrecht sauer. Sie fragten, was der Vater dazu sagte und als ich meinte, er wisse nichts davon, rieten sie mir, mit ihm zusammen wiederzukommen. Ich war so verwirrt und tat es dann zwei Tage später auch. Auch da sprach wieder nichts gegen ein Kind. Außer mir. Dennoch gaben sie mir am Ende widerwillig das Go. Ich verfiel zu Hause in eine tiefe Lethargie und fühlte mich dumpf. Sie hatten mir vom Herzschlag, der weiteren Entwicklung des Embryos und von der Tatsache, dass ich einem Lebewesen den Eintritt auf diese Erde verwehren würde, erzählt. Im Internet fand ich zu dem Thema extrem viele Seiten und Berichte von Abtreibungsgegnern. Es gab abartige Bilder von zerteilten Föten und ich las auf Internetseiten wie „pro leben” Berichte von Frauen, die abgetrieben haben und es bereuten.
Ich fühlte mich schuldig und dreckig. Von meiner ersten, sich gut anfühlenden Entscheidung gegen das Kind war nichts mehr übrig. Ich fühlte mich wie eine Mörderin. Trotzdem wollte ich nicht Mutter werden. Mir wurde die Entscheidung dann aber abgenommen. Ich bekam keinen frühen Termin in den umliegenden Krankenhäusern. Praxen, die eine Abtreibung durchführen konnten, fand ich innerhalb der kurzen Zeit nicht. Alle meine verzweifelten Versuche auf den letzten Drücker scheiterten. Heute bin ich alleinerziehende Mutter einer 4-jährigen Tochter. Ich liebe sie und sehr und bin froh, dass es sie gibt, aber meine Träume und meinen Weg, den ich mir mühsam für mich ausgemalt habe, kann ich erstmal nicht gehen. Ich habe einen großen Teil von mir durch diese zwei Wochen zwischen Schwangerschaftstest und der endgültig verpassten Chance, abzutreiben, verloren. So hart es auch klingen mag. Aber ich habe einen anderen großen Teil dazu gewonnen und das ist meine Tochter.

Marie, 24*
Ich recherchierte im Internet und fand die Bestätigung, dass eine Abtreibung in Deutschland unmöglich ist. Also ging ich ins Ausland.
Es war November 2017. Ich war 23 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ich hatte die Veränderungen an meinem Körper nicht bemerkt, vielleicht habe ich sie auch ignoriert bis mich meine Mutter auf meinen „aufgeblähten“ Bauch ansprach. Da traf es mich, ich bemerkte plötzlich die Veränderungen an meinem Körper: der größere Bauch, die größeren Brüste. Das alles war ungewöhnlich. Und dann die Übelkeit, die ich immer wieder auf Stresssituationen geschoben hatte. Es waren keine zwei Wochen vergangen, seitdem ich mich von meinem Freund getrennt hatte, zudem steckte ich in einer stressigen Lernphase und arbeitete in Vollzeit. Dass ich meine Tage nicht bekommen hatte, hat mich nicht weiter gewundert, da ich sie nie regelmäßig bekam. Ich verbrachte eine schlaflose Nacht. Insgeheim wusste ich, dass ich schwanger war. Auf dem Weg zur Arbeit am nächsten Tag hielt ich bei der Apotheke und kaufte einen Schwangerschaftstest. Dann die Gewissheit: schwanger. Daraufhin ging ich zum Frauenarzt und es wurde eine Schwangerschaft in der 14. Woche festgestellt. In Tränen aufgelöst sagte ich immer wieder, dass ich „es“ nicht behalten möchte. Die Ärztin aber beglückwünschte mich und wollte meine Situation nicht verstehen. Ich sagte ihr, dass gerade eine Welt für mich zusammenbreche und dass ich mich nicht in der Mutterrolle sähe. In ihrem Unverständnis fuhr sie einfach fort, sagte, dass es dem Kind gut gehe und welche Untersuchungen nun anstünden. Auf eine Abtreibung hätte ich keine Chance, da ich in der 14. Schwangerschaftswoche wäre.
Eine Abtreibung in Deutschland war unmöglich. Also ging ich ins Ausland.
Auf meine Aussage, dass ich das Kind aber nicht bekommen möchte, sagte sie nur, da führe kein Weg dran vorbei, ich könne es später zur Adoption freigeben, müsse es aber austragen. Auch das stand für mich nicht zur Debatte. Ich recherchierte daraufhin im Internet und fand die Bestätigung, dass eine Abtreibung in Deutschland unmöglich sei. Also ging ich ins Ausland – in mein Heimatland auf dem Balkan. Meine Eltern fanden für mich eine Klinik und einen Tag später saß ich im Flugzeug. Um 8 Uhr morgens hatte ich den Termin, es wurde alles besprochen und untersucht. Ich wurde von dem behandelnden Arzt nicht verurteilend gemustert, sondern einfach „behandelt“. Ich wurde für den Eingriff vorbereitet und die Abtreibung wurde durchgeführt. Als ich aufwachte, war mein erster Gedanke: Es ist vorbei. Ich bin wieder ich und habe mein Leben zurück. Es hatte sich in den letzten 3 Tagen wie ein Albtraum angefühlt und nun war es vorbei. Ich habe meinen Bauch angefasst und gelächelt. Im Nachhinein dachte ich, dass mich vermutlich viele für meine Vorgehensweise verurteilen, aber für mich war es die richtige Entscheidung, ich bereue sie nicht. Es ging damals alles sehr schnell und das musste es auch, weil mir die Zeit davonlief. Ich habe 3 Tage und 2000 Euro gebraucht, um mein Leben zurückzubekommen. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es gelaufen wäre, hätte man mir diese Möglichkeit verwehrt.

Alima, 29*
Die andere Frau sagte, dass sie meine Situation verstehen könne, ich in Zukunft aber aufpassen solle. Ein Kind Gottes mache auch nicht vor Allah halt.
Meine Familie und ich kamen vor mehr als 20 Jahren nach Deutschland. Wir sind Muslime. Mein Vater war in unserer Heimat ein Fiqu-Gelehrter und damit streng gläubig. Ich hatte immer den Eindruck, dass meine Mutter nicht so gläubig war und orientierte mich in Deutschland mehr an ihr. Sie war sehr schlau, modern und gutmütig. Mein Vater und sie stritten ständig wegen unserer Heimat, dem Islam und dem neuen Land, in dem so vieles “harram” ist. Die Strenge meines Vaters, vor allem, was unseren Glauben anging, machte mir Angst. Ich fühlte mich nicht sehr wohl in seiner Nähe. Meine Mutter mochte Deutschland und die Leute mehr als mein Vater, sie lernte mit uns zusammen schnell Deutsch, mein Vater kann es bis heute kaum. Mit 17 verliebte ich mich sehr in einen Deutschen. Ich fühlte mich erst dreckig und schuldig, aber ich hatte noch nie so ein Glück empfunden.
Meine Mutter wusste es. Zuhause mussten wir aber alles vor meinem Vater verheimlichen. Auch den Frauenarztbesuch, den meine Mutter bald mit mir machen wollte. Weil ich einen deutschen Freund habe, wollte sie, dass ich verhüte. Ich war damals sehr erschrocken. In unserer Religion darf man keinen Sex vor der Ehe haben. “Zina” (Unzucht) kommt da direkt hinter Mord. Wir stritten uns damals sehr. Ich unterstellte meiner Mutter, eine Ungläubige zu sein. Ich hatte schreckliche Angst vor Allah, meinem Vater und Sex. Aber in der Schule war ich fast die einzige Muslimin und alle um mich herum hatten Sex. Ich fühlte mich irgendwann dazu gedrängt und ging mit meiner Mutter zu einer Frauenärztin. Sie trug ein Hidschab und kannte meine Mutter gut. Sie klärte mich geduldig über alles auf und verschrieb mir die Pille. Kurz darauf hatte ich das erste Mal Sex mit meinem Freund. Ein paar Monate später ging ich den dritten Tag in Folge nicht zur Schule, weil mir so übel war. Ich hatte andauernd Schwindelanfälle und übergab mich. Meine Mutter fuhr mit mir zum Arzt. Auch unser Hausarzt war Muslim. Mein Vater erlaubte keinen anderen Arzt. Er untersuchte mich und fragte mich aus. Irgendwann blickte er meine Mutter mit großen Augen an und sagte auf arabisch, dass es sich hierbei um eine Tragödie handeln würde und er in diesem Fall damit nichts zu tun haben wolle.
Meine Mutter sagte: Wir müssen es wegmachen. Sofort.
Meine Mutter packte mich am Arm und fuhr mit mir zur Frauenärztin. Da verstand ich dann sofort und klappte zusammen. Ich erinnere mich kaum noch. Alles war wie im Nebel. Sie testete mich, ich war schwanger. Meine Mutter und sie redeten abwechselnd auf mich ein. Was mit der Pille sei, wie das passieren konnte. Ich weinte durchgehend. Meine Mutter sagte plötzlich: Wir müssen es wegmachen. Sofort. Die Ärztin sagte, sie mache sowas nicht. Außerdem sei ich bereits in der 8. Woche und ab jetzt sei es Mord. Im Islam ist die Tötung des Embryos verboten und nur in Ausnahmen bis zum 40. – 42. Tag nach der Befruchtung gestattet. Meine Mutter tröstete mich im Auto, aber sie wirkte verzweifelt. Zuhause suchten wir nach Ärzten, die Abtreibungen durchführten, fanden aber keinen. Wir riefen in Krankenhäusern an. Zwei sagten, sie können dazu am Telefon keine Informationen herausgeben. Ein anderes sagte, sie bräuchten erst die Genehmigung einer Beratungsstelle, um einen Termin für eine Untersuchung machen zu können. Sie gaben uns zwei Nummern. Eine Woche später fuhr ich mit meinem Freund zu einer Beratung. Er hatte sich über die Nachricht gefreut, verstand meine Situation aber und unterstützte mich. Bei der Beratung war es grausam. Ich erklärte die Situation mit meinem Vater und der Sache mit der Jungfrau vor der Ehe. Die eine Frau sagte mir, dass ich dazu wohl stehen müsse und dass man sich hier in Deutschland immer für das Wohl des Kindes entscheide, solange keine Vergewaltigung vorläge. Mein Freund wehrte sich für mich und die andere Frau sagte, dass sie meine Situation verstehen könne, ich in Zukunft aber aufpassen solle. Ein Kind Gottes mache auch nicht vor Allah halt. Der Satz ist mir bis heute in den Ohren geblieben.
Sie genehmigten die Abtreibung und ich fuhr nach Hause. Was mich da erwartete, sollte mein ganzes Leben verändern. Mein Vater stand brüllend im Wohnzimmer und schmiss Dinge um sich. Als er mich sah, schrie er auf mich ein. Er wusste es. Ob es ihm der erste Arzt, der auch ein guter Bekannter von ihm war, gesagt hatte, wussten wir nicht. Aber bis heute können wir uns das nicht anders erklären. Mein Vater weinte dann. Er beschimpfte mich laut auf arabisch. Meine Mutter hielt mich im Arm. Mein Vater sagte am darauffolgenden Tag: “Du darfst nicht abtreiben.” Er sagte, dass ich schon zwei riesige Sünden begangen habe, eine dritte werde er nicht zulassen. Ich sollte das Kind bekommen. Im Geheimen. Eine Woche später hatte ich mein mündliches Abitur. Danach wurde ich isoliert. Ich fühlte mich nur noch wie ein Körper. Wie eine Hülle. Mein Freund rief damals nochmal bei der Beratung an, um einen Rat zu bekommen. Die sagten aber nur, wenn ich nicht abtreiben darf, können sie nichts tun. Ich bekam einen Sohn. Er ist jetzt 10. Mein Vater hat meinen Freund akzeptiert, da war unser Sohn bereits 6. Jetzt leben wir seit 4 Jahren zusammen in Köln. Ich wollte studieren. Ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden. Jetzt bin ich Mutter. Aber mein Freund arbeitet hart und in einem Jahr möchte er auf Teilzeit umsteigen und mir ein Studium ermöglichen. Dann möchte ich Medizin studieren und Frauenärztin werden.
* Namen von der Redaktion geändert
Fotos: Joanna C. Schröder