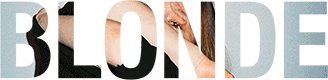Wegen ihrer Depressionen haben sich Freund*innen von unserer Autorin abgewandt. Zum Selbstschutz baute sie daraufhin eine Mauer auf. Doch dann kam Greta und zeigte ihr, dass sie die Krankheit nicht zu einer schlechteren Freundin macht. Was das für sie bedeutet, schreibt sie Greta in einem Brief. Triggerwarnung: In diesem Text werden Suizidgedanken erwähnt.
Liebe Greta,
Als ich vor fast sieben Jahren neu nach Hamburg gezogen bin, hatte ich nicht nur den schlimmsten Kater meines Lebens, sondern auch große Angst. Angst, dass ich zum ersten Mal alleine in einer neuen Umgebung war. Angst, dass ich mein zweites Studium – wie das erste auch – wegen meiner Depressionen abbrechen muss. Und vor allem Angst, dass ich keine Freund*innen finden werde.
Depressionen im Handgepäck
Doch das erste halbe Jahr lief gut. Ich fand Anschluss in der Uni, mochte meinen Studiengang und fand sogar ziemlich schnell eine Therapeutin, mit der ich einmal die Woche sprechen konnte. Mein Leben lief in halbwegs geregelten Bahnen ab und das fand ich mit damals 20 Jahren mehr als gut. Aber wie das immer so ist mit psychischen Krankheiten, vergisst man sie in Hochphasen schnell. Depression? I don’t know her! Sie konnte sich jedoch gut an mich erinnern und stattete mir vier Monate nach meinem Umzug in die große Stadt einen Besuch ab. Und zwar nicht mit Salz und Brot, wie man das sonst macht, sondern mit erdrückender Traurigkeit, Erschöpfung und Motivationslosigkeit. Naiv wie ich war, wendete ich mich an meine damalige „engste Freundin“, ich nenne sie hier mal Paula. Ihr erzählte ich von meinen Problemen. Wir hatten bereits vorher darüber gesprochen und durch ähnliche Erfahrungen eine Verbindung aufgebaut. Dachte ich. Dann vibrierte mein Handy. Eine Nachricht von Paula: „Wir finden alle, dass gerade am Anfang einer Freundschaft die positiven Momente die negativen überwiegen sollten. Und das ist bei dir einfach nicht so.“ An den Rest kann ich mich heute nicht mehr erinnern. Nur die zwei Zeilen haben sich für immer in mein Gedächtnis gebrannt. Ich muss dir natürlich nicht sagen, dass ich danach noch tiefer in mein ohnehin schon bodenlos scheinendes Loch viel.
Ich machte nie ein Geheimnis aus meiner Krankheit und auch dir erzählte ich schnell davon. Hauptsächlich, um dir zu zeigen, dass ich stark und trotz dieser oft falsch als „Faulheit“ dargestellten Krankheit voll funktionstüchtig war.
Drei Jahre, zwei Therapeutinnen, eine Nacht am Fenster des 5. Stocks und ein Klinikaufenthalt später, hatte ich mir stolz eine dicke Mauer gebaut. Sie war bunt und voller Selbstironie, aber sie schützte mich davor noch einmal so verletzt zu werden wie von Paula. Ich konnte immer schon vieles alleine schaffen, deshalb legte ich meinen schwarzen Hund [Metapher für Depressionen nach Autor Matthew Johnstone, Anm. der Redaktion] an die Leine und verbannte ihn hinter die Mauer. So wusste nur ich von ihm. Und dann kamst du. Ich fing gerade mein drittes Studium an – auch das zweite hatte ich auf Grund meiner Depressionen wie vorausgesagt abgebrochen – und es war der erste Tag an der neuen Uni. Du warst eine von meinen 18 Kommiliton*innen und heute weiß ich, dass du genauso nervös warst wie ich. Wir fingen an, uns bei gemeinsamen Raucherpausen zu unterhalten und besser kennenzulernen. Es folgten gemeinsame Projekte und Abgaben. Ich machte nie ein Geheimnis aus meiner Krankheit und auch dir erzählte ich schnell davon. Hauptsächlich, um dir zu zeigen, dass ich stark und trotz dieser gesellschaftlich oft falsch als „Faulheit“ dargestellten Krankheit voll funktionstüchtig bin war. Jetzt muss ich darüber lachen. Es hört sich fast so an, als hätte ich dir damals einen Sportwagen verkaufen und nicht den Grundstein für eine engere Freundschaft legen wollen. Du nahmst es gut auf und erzähltest mir von deiner Schulfreundin, die ebenfalls psychisch erkrankt ist und mit der du schon einiges erlebt hattest. Aber selber seist du nicht betroffen.
Mit dem Kopf durch meine Mauer
Das hat mich beschäftigt. Zwar wünschte ich niemandem Depressionen, aber wie solltest du mich in depressiven Phasen verstehen können, wenn du selber noch nie eine durchlebt hattest? Du würdest dich wie viele andere vergangene Freund*innen in die Reihe der „Steh doch einfach auf“ oder „Ich bin auch manchmal traurig“ Sager*innen reihen. Also hielt ich weiterhin etwas Distanz, auch wenn wir uns näher zusammenkamen. Irgendwann erzählte ich dir sogar von meiner Erfahrung mit Paulas Kommentar, dass mit mir das „Negative“ überwiegen würde. Es war nur eine Anekdote, die mir in einem Gespräch eingefallen war und ich dachte eigentlich, dass sie einen Lacher aus dir kitzeln würde. Aber das war nicht so. Du warst geschockt und besorgt und das machte mich nervös und meine Mauer bröckelte leicht.
Aber nach diesem Moment kamst du mit dem Vorschlaghammer. Du wusstest, wann ich lüge, wenn du nach meiner Stimmung fragtest, und liest nicht locker, bis ich ehrlich war. Du hörtest mir zu, als ich aus meiner toxischen Beziehung herauskam und endlich erzählen konnte, was dort wirklich los war. Sogar bei dir und deiner Familie hast du mich wohnen lassen, als ich keine Wohnung mehr hatte. Du sprachst immer mehr von deiner Schulfreundin und irgendwann wurde mir klar, dass du damals die einzige Vertraute für dieses Mädchen warst und bis heute teilweise noch bist. Ich habe nach und nach verstanden, dass du mir nichts Böses wolltest, sondern ernsthaft daran interessiert warst, dass es mir gut geht.
Codewort: Rotes X
Obwohl du mittlerweile die Mauer eingerissen und meinen schwarzen Hund am Bauch kraulen konntest, fiel es mir trotzdem noch schwer, immer ehrlich zu sein. Die Angst, dass du mich doch wegen meiner Krankheit und was damit verbunden ist nicht mehr in deinem Leben haben wolltest, war groß. Mittlerweile nervt es dich, wenn ich sage: „Du gibst aber Bescheid, wenn dir das doch zu viel ist!“, oder erst nach mehrfachem Nachfragen deinerseits ehrlich antworte. Deshalb haben wir das rote X eingeführt. Besser gesagt, du hast es eingeführt. Immer, wenn es gar nicht mehr geht, ich mit Suizidgedanken zu kämpfen habe oder mir Horrorszenarien in meinem Kopf ausmale, soll ich dir diesen Emoji schicken und du weißt, was los ist. Das funktioniert sicher längst nicht für alle Betroffenen, aber für uns sollte es das.
Ich bin dir nie zu negativ und unsere Freundschaft war auch nicht von Anfang an nur mit positiven Erfahrungen versehen. Aber du hast akzeptiert, dass diese Krankheit zu mir gehört und vermutlich auch für immer ein Teil meines Lebens sein wird.
Was danach passieren würde, hast du nie weiter ausgeführt. Musstest du auch nicht, denn bis heute habe ich ihn noch nicht einmal benutzt. Während ich diesen Brief an dich verfasse ist mir aufgefallen, warum. Es liegt nicht daran, dass ich keine depressiven Phasen mehr hätte, sondern einfach daran, dass ich dich mittlerweile direkt anrufe, wenn es mir schlecht geht. Ich weiß, wir haben uns Grenzen gesetzt, aber seit über drei Jahren bist du da und über die Zeit habe ich unterbewusst verstanden, dass ich keine Angst haben muss, dass du auf einmal wegläufst, weil ich dir zu viel bin. Manchmal kommen die Gedanken trotzdem noch, aber jedes Mal aufs Neue zeigst du mir, dass ich mir wieder zu viele Sorgen gemacht habe. Ich bin dir nie zu negativ und unsere Freundschaft war auch nicht von Anfang an nur mit positiven Erfahrungen versehen. Du sollst wissen, dass ich genauso für dich da bin, wenn du einmal meine Hilfe brauchst. Du hast akzeptiert, dass diese Krankheit zu mir gehört und vermutlich auch für immer ein Teil meines Lebens sein wird. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass sie mich nicht zu einer schlechteren Freundin macht.
Wehe du weinst jetzt. Ich kann doch so schlecht mit Tränen umgehen.
Miriam
Dieser Beitrag wurde ursprünglich am 11. Februar 2022 veröffentlicht.
Mehr Geschichten zum Support unter Freund*innen lest ihr hier:
„Nur Liebe für diese Frau“ – Ebow und Balbina über ihre Freundschaft & die Power ihrer Kunst
Amandla Stenberg über Freundschaft, Internet und Schönheit
5 Serien über Familien, die nichts mit Verwandtschaft zu tun haben