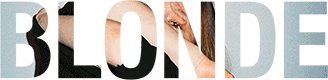Es gibt Worte mit Verfallsdatum, bereit für den sprachlichen Mülleimer. Über das N-Wort-Verbot, Sensibilisierung in der Kommunikation und eine sich im Wandel befindliche Jugendsprache, die selbst Millennials googlen müssen.
Sprache steht niemals still. Deutsch kann das als lebendige Sprache gar nicht – und darf es auch nicht. Denn Worte sind so etwas wie der Spiegel unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Der Umfang des deutschen Wortschatzes wird, je nach Sicht- und Zählweise auf 200.000 bis 500.000 geschätzt. Neue Wörter, sogenannte Neologismen, kann jede*r vorschlagen. Gesammelt und wissenschaftlich auf ihre Gängigkeit geprüft werden sie vom Leibnitz Institut für Deutsche Sprache (IDS). Neologismen unterliegen stetig weiterer Prüfung, denn sie können sich als kurzzeitigen Trend herausstellen. Es ist so: Neue Wörter kommen schneller in den Sprachgebrauch, als sie in Alltags- oder Rechtschreibwörterbücher aufgenommen werden. Was der sprachliche Wandel aufzeigt, sind die Wechselwirkungen zwischen den Menschen und ihrer sich stetig verändernden Umwelt, erklärt Ekkehard Felder, Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Heidelberg: „Wir positionieren uns immer neu und das ist gut so. Daraus stammt das Bedürfnis, Bekanntes neu zu formulieren.“ Da stellt sich die Frage, welche Worte ein Verfallsdatum haben.
Notiz: Dieser Beitrag ist zuerst in unserer aktuellen Ausgabe #048 im April 2020 erschienen.
Diese Wörter sind längst abgelaufen
„Wir befinden uns in einer Sensibilisierungsphase bestimmter Begriffe, vor allem aus dem Identitätssektor, ähnlich wie zuletzt während des Hochs der feministischen Linguistik“, so erklärt Prof. Felder unsere Zeit, in der gesellschaftlicher Druck zu Änderungen in der Sprache führen kann. Laut der Soziolinguistin Dr. Reyhan Şahin haben außer der feministischen Linguistik der 1970er-Jahre auch die Gender-Linguistik seit den 1990ern plus die Antirassismusarbeit von BiPoC-Bewegungen in Deutschland einiges an wichtiger Vorarbeit geleistet.
„Wir sollten aus ihr schöpfen und lernen, um Sprache im positiven Sinne neu mitzugestalten.“
Eines der medial wohl am präsentesten Beispiele des sprachlichen Wandels ist die Debatte um das N-Wort. Nachdem das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern Ende vergangenen Jahres entschieden hatte, dass dieser Begriff, der ausschließlich der Herabwürdigung anderer diente, weiterhin im Schweriner Landtag verwendet werden dürfe, unterschrieben bisher über 120.000 Menschen eine von Charlotte Nzimiro ins Leben gerufene Petition, die sich gegen das Urteil wehrt. Eine weitere Aktivistin, die sich für ein Verbot im Sprachgebrauch stark macht, ist die Moderatorin Aminata Belli: „Gewisse Worte haben eine so tiefe Geschichte, so viel Bedeutung und so viel Macht, dass die Benutzung dieser Wörter, egal mit welcher Intention, einen körperlichen und seelischen Schmerz auslöst. So ist es beim N-Wort. Als Kind dachte ich fälschlicherweise nur, ich würde sensibel darauf reagieren.“ Heute weiß Belli, dass fast jede*r Betroffene so empfindet. Für sie sei der richterliche Beschluss das beste Beispiel für das deutsche Unverständnis von Rassismus und dessen Struktur sowie den nicht vorhandenen Umgang mit der eigenen Kolonialgeschichte. Für Belli und Nzimiro, nur zwei der unzähligen Krieger*innen im Kampf für ein respektvolles Miteinander, steht fest: Ihr Feldzug hat gerade erst begonnen. Ihre Armee versammelt sich weiter im Netz auf Instagram und Twitter, aber auch im echten Leben bei Demonstrationen und Talks.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Darf man ein Wort wie das N-Wort verbieten, fragen wir auch Prof. Felder. „Es war eigentlich schon akzeptiert, dass man es nicht verwenden sollte“, sagt er. Viele, so Prof. Felder weiter, hätten es aus Naivität weiter verwendet, sich aber ab den 1980er-Jahren davon entfernt, als deutlich wurde, wie sehr es zur Stigmatisierung Schwarzer Menschen beitragen würde. Provokationen wie die im Landtag Mecklenburg-Vorpommern blieben dennoch nicht aus. „Es ist nicht leicht, sprachwissenschaftlich auf diese Provokationen zu reagieren. Das N-Wort sollte man nicht sagen, denn es ist in der Konvention stigmatisiert. Im Wort selbst steckt keine Eigentlichkeit.“ Das Problem stecke vielmehr im Sprachgebrauch und in seiner Geschichte.
Du, Duden, wir müssen reden
Nzimiro und Belli einen Schritt voraus im sprachlichen Sensibilisierungskampf sind die homosexuellen „Schwanz und ehrlich“-Podcaster Lars Tönsfeuerborn, Mirko Plengemeyer und Michael Overdick. Sie haben mit ihrer Petition bereits eine Änderung im Duden erreichen können. Den Aufruf startete Tönsfeuerborn zusammen mit seinen Kollegen, nachdem er bei Deutschlands erster TV-Dating-Show für schwule Männer das Herz des „Prince Charming“ gewinnen konnte. Ab sofort findet man unter dem Wort „schwul“ nicht länger diskriminierende Beispielsätze wie „Die Klassenfahrt war voll schwul“, sondern einen Appell an die Menschlichkeit:
„Die Verwendung des Adjektivs ,schwul‘ in diesem Sinne gilt als diskriminierend und sollte vermieden werden.“
Ein geglücktes Beispiel für einen sprachlichen Wandel, der ein respektvolleres Miteinander priorisiert, die Wünsche betroffener Gruppen anhört und ihnen nachspricht, statt sie weiter zu beleidigen.
Ähnlich wie mit dem Wort „schwul“ – das trotz seines positiven Reclaimings von Seiten der Homosexuellen-Bewegung in den 70ern, später im Hip-Hop-Kontext der 90er-Jahre wieder negativ gebraucht wurde und so auch in jugend- und umgangssprachliche Sprechweisen übergegangen war – verhalte es sich mit der Bezeichnung „Kanake“. Dazu erklärt Dr. Şahin: „Begriffe können nicht nur veralten und irgendwann durch neuere Bezeichnungen ersetzt werden, sondern sie machen in der Regel auch einen Bedeutungswandel durch. Das heißt, ihre semantischen Referenzbereiche, also das, was sie bedeuten, können sich je nach Zeitgeist und Epoche ändern. Ebenso können Wörter aus bestimmten Sprachvarietäten, wie zum Beispiel aus der Jugendsprache, in die Umgangs- und Standardsprache übergehen.“ Bei solchen sogenannten Geusenwörtern ginge es um gesellschaftspolitische Machtstrukturen. Dazu würden sich betroffene Menschen Ausdrücke, die innerhalb der deutschen Mehrheitsgesellschaft früher als rassistische Beschimpfung galten, später aneignen und positiv umdeuten. Ein Beispiel dafür ist die „Kanak Attack“-Bewegung, so die Expertin. „Sie bestand hauptsächlich aus der zweiten Generation, also den Nachkommen, von Arbeitsmigrant*innen aus der Türkei, Italien, Ex-Jugoslawien oder Portugal und benutzte sie als antirassistische Selbstbezeichnung und Abwehr, um ihre negative Beleidigungskraft abzumildern und sie unwirksam zu machen.“ Und da wären wir letztendlich bei der politischen Ebene von Sprache: „Sprache kann für politische Zwecke eingesetzt werden und manipulieren. Sprache kann verletzen oder aber auch empowern“, unterstreicht Dr. Şahin.

Das Internet spricht mehr als Emoji
Apropos Empowerment: Worte drücken dort Zugehörigkeit aus, wo man sie vielleicht auf den ersten Blick nicht erwartet: im Internet. Unter Hashtags versammelt sich bei Instagram und Twitter eine Gemeinschaft voller Solidarität. Solidarität für die Opfer der rechtsextremistischen Angriffe in Hanau kommen unter #WeAreHanau zusammen. #WirBleibenZuHause signalisiert in Zeiten der Corona-Pandemie, dass uns die Gesundheit unserer Mitmenschen genauso am Herzen liegt wie die unsere. Und der Hashtag #MeToo ist sogar zu einer weltweiten Bewegung jener Menschen geworden, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Gemeinschaft ist im Netz manchmal einfacher als IRL. Hass aber auch.
1913, lange vor Hashtags und Petitionen, beschäftigte sich Schriftstellerin Gertrude Stein mit den Funktionen und der Symbolik von Wörtern. Von ihr stammt dieses lange Zeit wegweisende Beispiel in der Semantik: „A rose is a rose is a rose.“ Sie glaubte, Worte verwiesen auf nichts anderes als auf sich selbst. Aber trifft das zu? Ganz und gar nicht, meint Dr. Şahin:
„Wörter verweisen nicht nur auf sich selbst, sie können ambig, also mehrdeutig, sein und auch genau das Gegenteil ausdrücken von dem, was sie eigentlich bedeuten.“
Kein Vorwurf an Frau Stein, denn sie konnte die Entwicklung durch heutige Kommunikationsformen und Social Media kaum vorhersagen.
Im Netz, so Prof. Felder, drücke sich die Gesellschaft weniger formell – aber aussagekräftiger und extremer – aus als im reellen Leben. Gerade deswegen plädiert Dr. Şahin darauf, Begriffe weiterhin zu hinterfragen, denn sie können Minderheiten und marginalisierte Menschen verletzen. „Gendersensible und rassismuskritische Sprache ist etwas Gutes. Lernt sie und gestaltet damit Sprache im positiven Sinne neu!“
Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache hat in den vergangenen Jahren vor allem Wörter aus dem Digitalisierungskontext wie „Digital Detox”, „E-Scooter” und „Parshippen”, aber auch Begriffe wie „Menstruationstasse” oder „Manspreading” in die Liste der Neologismen aufgenommen. Unter Beobachtung stehen seit März auch „ASMR”, „Bodyshaming”, „failen”, „toxische Männlichkeit” und „woke”. Buzzwords aus der Corona-Epidemie wie „Social Distancing” liest man dort noch nicht. „Sie werden sicher folgen”, so Dr. Annette Trabold, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit am IDS.
Bleibt zu hoffen, dass die Gesellschaft mit dem schnellen digitalen Wandel Schritt halten kann und sich auch Richter*innen gegen Wörter der Alltagsdiskriminierung sensibilisieren. Damit diese endgültig im Mülleimer der Sprachgeschichte landen.
Dieser Beitrag ist ursprünglich am 21. April 2020 online erschienen.
Mehr Beiträge darüber, wie wir sprechen:
Bye Body-Shaming, Sexualisierung und Schönheitsideale: Die neue Körpersprache
Muttersprache – Charlotte und Polly Roche in der BLONDE-Coverstory
Antirassistisch handeln: Diese Organisationen könnt ihr unterstützen, bei diesen Quellen könnt ihr euch informieren