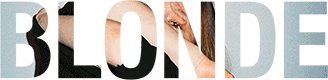Nerd-Dasein, Gender Gap, Generationenkonflikte: Seit Jahrzehnten kämpfen Gaming und Co. gegen gängige Klischees. Beim „MQ! Summit” von Audi räumt eine damit auf, die Bescheid weiß: Dr. Johanna Pirker ist Forscherin und Dozentin für Game-Design, Virtual Reality und künstliche Intelligenz. Im BLONDE-Interview erklärt sie, warum Videospiele bald unsere Geschichten erzählen, Virtual Reality längst zum Schul-Stoff gehört und beide langsam zu Orten der Vielfalt werden.
Dr. Johanna Pirker ist in der digitalen Welt zuhause, in diesem Jahr aber hat sie ihre analoge Heimat kennengelernt. Statt wie sonst zu Lesungen auf der ganzen Welt zu reisen, durchquerte die 32-Jährige in der Quarantäne Österreich. Das erzählt sie im Videocall. Von ihrer Wissenschaft fernhalten konnte die Pandemie Johanna trotzdem nicht: Ihre Vorlesungen hält sie jetzt von Graz aus. Dort studierte sie selbst an der TU und unterrichtet als Dozentin und Forscherin für Game-Entwicklung und -Design, Virtual Reality, Künstliche Intelligenz und Data Science. Von Graz aus nimmt sie auch am digitalen Innovations-Gipfel „MQ! The Mobility Quotient Summit” von Audi teil. In 25 Stunden voller Vorträge, Workspaces und Netzwerken widmete sich die digitale Veranstaltung dem Thema Mobilität. Dazu gehört auch, Gedanken zu mobilisieren, zum Beispiel dann, wenn es um die Innovation und Vorurteile gegenüber Gaming geht. Was das mit alten Informatik-Klischees zu tun hat und warum Wissenschaft nicht ohne Menschen auskommt, beschreibt Dr. Johanna Pirker im BLONDE-Interview.
Beim MQ! Summit geht es um Mobilität im Bezug auf Zeit, Raum, Nachhaltigkeit und soziale Strukturen. Auch deine Arbeitsbereiche fallen unter diese Themen. In welchem Feld verspürst du gerade den größten Vorstoß, wo tut sich am meisten?
Ich freue mich besonders, dass Games und das Umfeld von Virtual Reality gerade sehr positiv aufgenommen werden, weil sie ja zum Teil doch noch negativ behaftet sind, vor allem Videospiele. In meiner Wahrnehmung greifen viele Menschen, die sonst vermutlich andere Medien genutzt haben, nun zu Games und Virtual Reality. Bei Spielen wie „Animal Crossing“ war es schön zu sehen, wie darin auf einmal Hochzeiten gefeiert und Konferenzen abgehalten wurden. Für mich ist es schwierig, in einem Forschungsbereich wie Games Research zu arbeiten, in dem ich persönlich so viele Chancen sehe, es aber immer noch negative Vorurteile gegenüber den Technologien gibt. Ich glaube aber, dass die Lockdowns und Pandemie gezeigt haben, dass wir gerade dank dieser Technologie zusammen sein können, auch wenn wir voneinander entfernt sind.
In der Vergangenheit hat Johanna besonders die geschichtenerzählende Funktion von Gaming und Virtual Reality angesprochen. Als Beispiel nennt sie unter anderem das Videospiel „That Dragon, Cancer”. Spieler*innen schauen hier nicht nur zu, sondern nehmen aktiv am Kampf des vierjährigen Joel gegen seine Krebserkrankung teil. Johanna selbst wollte als Kind gerne Romane schreiben oder sich klassisch künstlerisch ausdrücken – nur war sie weder im Schreiben noch im Zeichnen besonders gut. Schließlich erlaubte es ihr das Erstellen von Games, kreative Gedanken „für andere erfahrbar zu machen“, wie sie betont.
„Menschen sagen mir, sie seien keine Gamer oder Gamerinnen, weil sie keine Zeit dafür hätten – als ob Gaming tatsächlich weniger wertvoll wäre, als stundenlang durch Instagram zu browsen oder ein Buch zu lesen.”
Was muss passieren, damit Games und Virtual Reality im Mainstream auf einer Stufe mit Büchern oder Filmen stehen?
Spiele werden immer noch falsch wahrgenommen, das möchte ich ganz klar ansprechen und aufzeigen, dass es viele verschiedene Arten gibt. Die Tools zur Kreation von Spielen sprechen mittlerweile aber eine immer größere Zielgruppe an. Heißt: Früher hat man Programmierer sein müssen, um ein Spiel zu entwickeln. Man musste die Physik eines Spiels ausarbeiten können, Bilder einladen, das war alles sehr viel Arbeit. Die aktuellen Game Engines nehmen einem da schon viel ab, sind aber dennoch dafür konzipiert, dass man sehr große Welten schafft. Es gibt aber ein paar, die zum Beispiel schon ermöglichen, interaktive und textbasierte Storys zu gestalten. Die unterlegt man dann vielleicht noch mit ein paar Bildern. Solche Programme sind so leicht zu bedienen: Man zeichnet nur einen kleinen Graphen und erkennt direkt die verschiedenen Wege, die man damit gehen kann. Sobald all das auf die große Masse stößt, sind wir an einem Wendepunkt, an dem auch andere Content Creator diese Tools übernehmen werden.
Was heißt das für Konsument*innen, die Games und VR nur von außen wahrnehmen?
Leider höre ich immer noch, dass Spiele nur für eine bestimmte Zielgruppe gedacht seien. Menschen sagen mir, sie seien keine Gamer oder Gamerinnen, weil sie keine Zeit dafür hätten – als ob Gaming tatsächlich weniger wertvoll wäre, als stundenlang durch Instagram zu browsen oder ein Buch zu lesen. Es fehlt die Wahrnehmung für das, was Games wirklich sind: Für mich beinhalten gerade Spiele wie „That Dragon, Cancer“ Erfahrungen, die ich sonst niemals im Leben machen könnte. Es ist ähnlich wie in einem richtig guten Dokumentarfilm, nur, dass ich eben dabei sein kann.
„Wenn man etwas nicht versteht, sollte man sich ein wenig damit beschäftigen. Vielleicht selbst spielen. Ausprobieren.”
Wer aber ist am Ende dafür verantwortlich, dass sich das Bild von Games bei Menschen ändert, die sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen?
Letztendlich wird diese Diskussion immer auf ältere Generationen abzielen. Meine ersten Videospiele habe ich schon gespielt, da war ich drei oder vier Jahre alt – und werde diese auch an meine Kinder weitergeben. Ich habe ein Verständnis dafür, was hinter einem Spiel wie „Fortnite” steckt – und was daran gut und vielleicht weniger gut ist. Wenn ich aber mit Eltern über Games spreche, schwingt oft nur sehr viel Angst mit. Warum? Weil man nicht versteht, was das Kind da spielt. Ich kann nur mitgeben: Wenn man etwas nicht versteht, sollte man sich ein wenig damit beschäftigen. Vielleicht selbst spielen. Ausprobieren.
Wer mitreden will, muss selbst erleben
In deinem TED-Talk weißt du darauf hin, dass die Gaming-Szene mittlerweile größere Finanzerfolge einfährt als zum Beispiel die Hollywood-Industrie. Warum sprechen wir im Mainstream dennoch mehr über Hollywood?
Das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Es wird immer darüber berichtet, wie die Einschaltquoten des traditionellen Fernsehens sinken, und wir wissen, dass die Zahlen von Plattformen wie Twitch, YouTube Live und Gaming-Kanälen wahnsinnig in die Höhe schießen. Für mich, die sehr viel Twitch und YouTube konsumiert, ist die Richtung, in die wir uns damit bewegen, sehr sichtbar und eindeutig. Um das zu verstehen, muss man aber über die eigenen Grenzen hinausschauen – ob es dabei um andere Generationen geht, Hobbys, Vorlieben oder Berufe. Im Gaming wächst eine Parallelgeneration heran, die sich total gut mit Tools auseinandersetzt und sie in erster Linie konsumiert. Das Phänomen Twitch, also warum ich anderen per Stream beim Videospielen zuschauen sollte, habe ich am Anfang selbst überhaupt nicht verstanden. Vermutlich ist das auch immer noch Typsache, ich habe dann aber trotzdem versucht, selbst mit Streaming anzufangen. Als Professorin ist das vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich will das Phänomen aber verstehen, damit ich überhaupt mitreden kann.
 Games verändern unsere Zukunft: Johanna beim diesjährigen „MQ! Innovation Summit”. // Bild: Audi
Games verändern unsere Zukunft: Johanna beim diesjährigen „MQ! Innovation Summit”. // Bild: Audi
Parallelgenerationen gibt es nicht nur im Gaming, sondern auch im Learning: Schon vor Jahren hat Johanna mit „Maroon” ein virtuelles Lehrprogramm entwickelt, in dem man bereits gefährliche Physik-Experimente rein virtuell durchführen konnte. Im Kontext von Homeschooling ist das gerade aktueller denn je.
Wünschst du dir manchmal, früher mit Programmen wie „Maroon” angefangen zu haben, um jetzt, wo solche Programme gefragt sind, in der Entwicklung schon weiter zu sein?
Wir haben bei „Maroon” mit den allerersten VR-Geräten angefangen, die für Consumer gedacht waren, wir hätten also gar nicht früher starten können. Als Experten für E-Learning und digitale Technologien sind mein Team und ich in der aktuellen Krise aber an Grenzen gestoßen, obwohl wir uns so viel mit diesen Themen beschäftigt haben. Was für andere Digitalisierungstreiber waren, sind für uns neue Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. „Maroon” hat sich durch die Krise hin zu einem kollaborativen Online-Projekt entwickelt. Während wir das Programm früher noch eher im Schulkontext gesehen haben, wo man mit Mitschülern direkt kommunizieren und Lernen konnte, sind wir jetzt zur Arbeit an Online-Avataren zurückgekehrt. Das ist lustig, denn von dort kommen wir ja eigentlich. Wir haben mit virtuellen Welten à la „Second Life” [eine virtuelle Online-Welt der frühen 2000er-Jahre, Anm. d. Red.] angefangen. Damals waren die nicht sonderlich erfolgreich, jetzt wäre der Bedarf danach eigentlich wieder ziemlich groß.
„Wir glauben fest daran, dass der Faktor Mensch sehr wichtig für die Forschung ist und was wir können nicht durch Maschinen ersetzt werden kann.”
Wie weit können wir mit simulierten Projekten wie „Maroon” im medizinischen oder wissenschaftlichen Bereich wirklich gehen? Auch im virtuellen Bereich gibt es ja Grenzen für das Ergebnis eines Experiments – das kann man schließlich nicht vorprogrammieren.
Mit Simulationen kann man schon sehr weit kommen, aber man berücksichtigt dennoch nicht alles. Es ist also schwierig, sehr komplexe Zusammenhänge perfekt nachzubilden. Deshalb haben mein Team und ich uns dafür entschieden, Simulationen und Experimentierräume zu gestalten, die für die Lehre gedacht sein sollen. Wir glauben stark daran, dass der Faktor Mensch sehr wichtig für die Forschung ist und was wir können nicht durch Maschinen ersetzt werden kann. Das sieht man am Beispiel des Computerspiels „Foldit“: Wenn man darin sehr komplexe Konstrukte baut, werden die an Wissenschaftler weitervermittelt und es kann sein, dass man damit tatsächlich Krankheiten heilen kann. Solche Zusammenhänge erkennt die Maschine noch nicht, weil sie zum komplex sind. Wir möchten deshalb mehr Menschen dazu motivieren, sich für Forschung und Wissenschaft zu interessieren und davon inspiriert zu werden. Wir brauchen genau die Köpfe, die an solchen Problemen arbeiten.
Wird Gaming diverser – und wenn ja, wann?
Wer aber genau sind diese neuen Köpfe? Welche Privilegien und welche demographischen Eigenschaften haben sie? Laut einer Online-Umfrage der Plattform Statista ist der Anteil von männlichen Game-Developer*innen innerhalb der vergangenen 6 Jahre lediglich um 5% gesunken, der von Frauen um nur 2% gestiegen. 5% ist ebenfalls der (niedrige) Wert für die Developer*innen, die non-binary oder andere Gender angegeben haben. Dabei gilt doch gerade Gaming oft als Ort, wo viele Identitäten Ausdruck finden, oder Johanna?
Wie ist dein persönlicher Eindruck von Vielfalt in der Gaming-Welt?
Es gibt nicht umsonst sehr viele Initiativen für mehr Diversität in dieser Industrie. Das trifft aber nicht nur auf Gaming, sondern auf alle technischen Welten zu. In der Informatik haben wir leider immer noch weniger Studienanfängerinnen als Anfänger. Wenn wir aber historisch zurückschauen, sehen wir, dass die Verteilung früher anders war, da gab es zu bestimmten Zeitpunkten viele Programmierinnen. In der Geschichte gibt es außerdem sehr viele bekannte Informatikerinnen. Mit der Zeit kam ein Umschwung in die entgegengesetzte Richtung – warum das so ist, verstehen wir selbst nicht zu hundert Prozent, dazu gibt es viele Theorien. Wir versuchen dennoch, diesen Status zu ändern, Klischees zu hinterfragen, umzukehren und aufzuzeigen, dass diese Welt eine bunte und kreative ist, die für alle Platz hat. In der Spieleentwicklung nehme ich wahr, dass das Umfeld diverser wird. Diese Studienwerte klingen zuerst einmal niedrig, wenn sie sich aber jedes Jahr so entwickeln, sieht man schon eine schöne Steigerung.
Ähnliche Werte gibt es auch in der Musikindustrie, in der zum Beispiel das Producing oft noch eine Domäne weißer cis Männer ist. Künstler*innen stellen daher immer häufiger ihre „rohen” Song-Daten online zur Verfügung, um den Produktionsprozess für mehr Menschen zugänglich zumachen. Wäre so etwas auch für die Game-Entwicklung denkbar?
Ja, wir sehen ganz klar den Trend zu unabhängigen Spiele-Entwicklungen, den „Rise of Indie Development”. Zur Entwicklungs-Plattform „Unity” habe ich selbst ein kleines Workshop-Format entwickelt, in dem ich Künstlern, Historikern, Archäologen oder Architekten beibringe, wie sie die Software ohne irgendwelche Programmierfähigkeiten nutzen können. Das Format ist so inspirierend, dass es schon zu Gründungsideen für Startups geführt hat. Es geht darum, dass eine Technologie leicht verwendbar ist, und das in einem ganz anderen thematischen Feld. So etwas macht die Spieleindustrie so viel bunter und wird in Zukunft noch zunehmen. Wir werden mehr Indie-Spiele sehen, die ganz anders sind, als alles, was wir jetzt gerade erleben. Dasselbe gilt für Virtual Reality. Deshalb teile ich meine Game Development Vorlesungen jetzt auch auf Twitch. Für mich ist es wichtig, dass dieses Wissen frei zugänglich ist und so viele wie möglich lernen können. Man spricht auch hier von der Demokratisierung der Game Engines.
Bock auf noch mehr neue Ideen? Hier entlang:
Aus Alge mach Mode: Im Interview mit Bio-Designerin Malu Lücking
Jetzt wird’s persönlich: Diese Kosmetikprodukte passen sich euch an
Über die Kommunikation mit sich selbst: Der große DNA-Report der BLONDE-Redaktion